Der Sandstein des Buntsandstein - das am weitesten
verbreitete Gestein im Spessart
Sandstein war das Gestein des Jahres 2008*
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main


Links. Der alte Steinbruch im Sandstein bei Heigenbrücken - der
Heigenbrückener Sandstein,
aufgenommen am 12.10.2002
Rechts: Natürliche Sandsteinskulptur in seiner
schönsten Form:
Der Delicate Arch im Arches National Park, USA, mit Joachim
LORENZ gegen den Schatten am Bogen in der Sonne,
aufgenommen am 03.09.1994,
*Wie es eine Pflanze, einen Vogel oder ein Insekt des Jahres
gibt, so wurde vom Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler
(BDG) und der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG)
auch ein Gestein des Jahres gekürt.
Sandsteine gehören weltweit zu den
häufigen Gesteinen, mit einer Verbreitung von Grönland bis zur
Antarktis (YOUNG et al. 2009). Sie sind oft bunt gefärbt, oft
mit einer verschiedenartigen Schichtung überliefert, ganz hart
bis weich, grob- bis feinkörnig, aber ebenso strukturlos
eintönig; und es gibt sogar Arten, die in dünnen Stücken biegsam
sind! Sandsteine sind Sedimentgesteine die zu mehr als 50 % aus
den Komponenten der Sandfraktion (0,063 - 2 mm) bestehen. Sie
werden auch als Arenite und Grauwacken bezeichnet. Verbreitet
sind Quarzsandsteine, wenn mehr als 25 % Feldspat enthalten
sind, sind dies Arkosen. Weiter gibt es auch Kalksandsteine,
pyroklastische Sandsteine, glaukonitische Sandsteine oder Kohle
führende Sandsteine.
Sie bilden eindrucksvolle Felsen, die nahezu jeder schon gesehen
hat, hier angeführt in einer beispielhaften, aber bei Weitem
nicht vollständigen Aufzählung:
- Roraima, Venezuela: Der höchste Wasserfall der Welt
(Salto Angel) mit einer Fallhöhe von fast 1 km stürzt über
(quarzitischen) Sandstein des Ayuan-Tepui zu Tal.
 Uluru (Ayers Rock), Australien: Der als
"Monolith" bekannte, runde Felsen im Herzen von Australien bei
Alice Springs besteht aus einem feldspathaltigen
Sandstein,
Uluru (Ayers Rock), Australien: Der als
"Monolith" bekannte, runde Felsen im Herzen von Australien bei
Alice Springs besteht aus einem feldspathaltigen
Sandstein,
aufgenommen am 27.03.2013 von Leo STEIGERWALD, Sailauf.
 Flinders Range, Südaustralien: Hier
wurden in den präkambischen Sandsteinen die Fossilien der
Ediacara-Fauna gefunden, die zur Namenbildung des Ediacariums
(635 - 542 Millionen Jahren) führte.
Flinders Range, Südaustralien: Hier
wurden in den präkambischen Sandsteinen die Fossilien der
Ediacara-Fauna gefunden, die zur Namenbildung des Ediacariums
(635 - 542 Millionen Jahren) führte.
Aufgenommen am 15.10.1982.
- Sidney-Basin, Blue Montains, Sidney, Australien: Große
Teile der Felsen, Schluchten und Felsabbrüche der langen Kette
der Blue Monutains werden von Sandsteinen gebildet.
 Monument Valley, Arizona, USA: Die sehr
markanten Inselberge in einer wüstenhaften Landschaft aus dem
De Chelly-Sandstein sind allen Rauchern und aus Westernfilmen
bekannt,
Monument Valley, Arizona, USA: Die sehr
markanten Inselberge in einer wüstenhaften Landschaft aus dem
De Chelly-Sandstein sind allen Rauchern und aus Westernfilmen
bekannt,
aufgenommen am 13.05.1981.
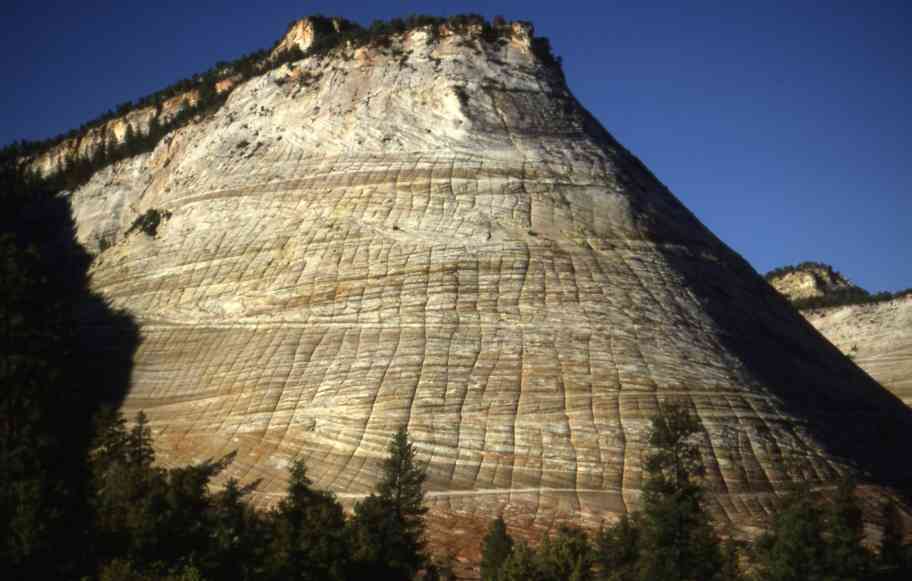 Checkerboard-Mesa aus einem Sandstein
mit Kreuzschichtung im Zion Canyon, Utah, USA: Die Schluchten
der Narrows und der riesigen Felswände des Zion Canyons
bestehen aus dickbankigen Navajo-Sandsteinen,
Checkerboard-Mesa aus einem Sandstein
mit Kreuzschichtung im Zion Canyon, Utah, USA: Die Schluchten
der Narrows und der riesigen Felswände des Zion Canyons
bestehen aus dickbankigen Navajo-Sandsteinen,
aufgenommen am 17.05.1981.
 Grand Canyon,
Arizona, USA: Ein Teil der hohen Felsbänke wird aus sehr
widerstandfähigen Coconino-Sandsteinen aufgebaut, die wohl
großartigste Landschaft der Welt,
Grand Canyon,
Arizona, USA: Ein Teil der hohen Felsbänke wird aus sehr
widerstandfähigen Coconino-Sandsteinen aufgebaut, die wohl
großartigste Landschaft der Welt,
aufgenommen am 09.05.1981.
 Goosenecks des San Juan River
in Utah: Der Fluss fließt etwa 300 m unter dem Aussichtspunkt
und bildet drei Mäander auf eine überschaubare Distanz in
einem dünn gebankten Sandstein,
Goosenecks des San Juan River
in Utah: Der Fluss fließt etwa 300 m unter dem Aussichtspunkt
und bildet drei Mäander auf eine überschaubare Distanz in
einem dünn gebankten Sandstein,
aufgenommen von Johann THUT am 12.09.2012.
 Antelope-Canyon bei Page, Arizona, USA: Die
farbenprächtigen, "gebogenen" und selektiv beleuchteten
Schichten des kleinen Canyons sind das Ziel von Fotographen
aus aller Welt,
Antelope-Canyon bei Page, Arizona, USA: Die
farbenprächtigen, "gebogenen" und selektiv beleuchteten
Schichten des kleinen Canyons sind das Ziel von Fotographen
aus aller Welt,
aufgenommen am 13.09.1994.
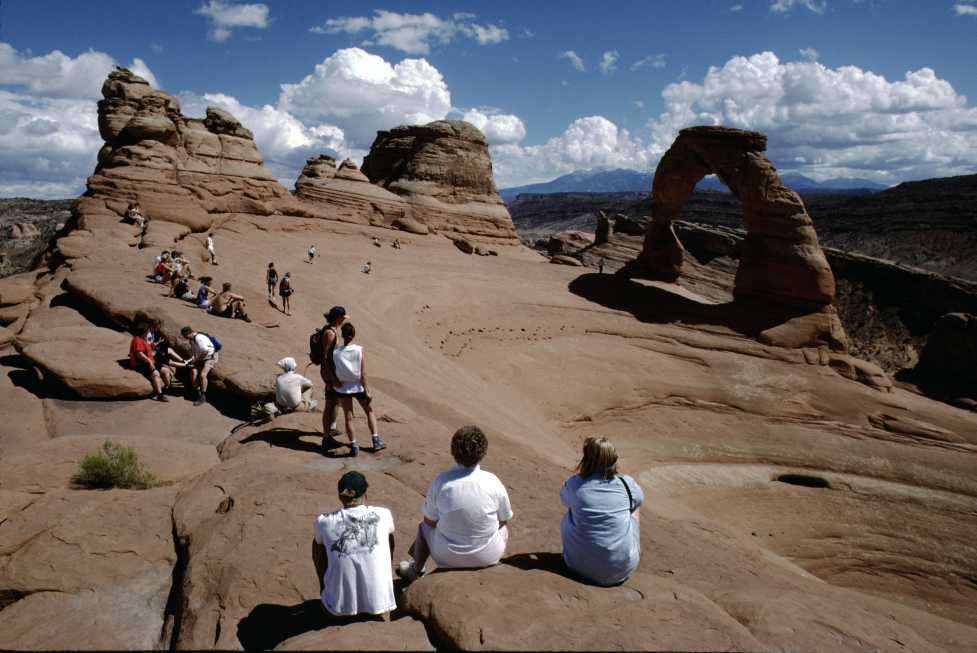
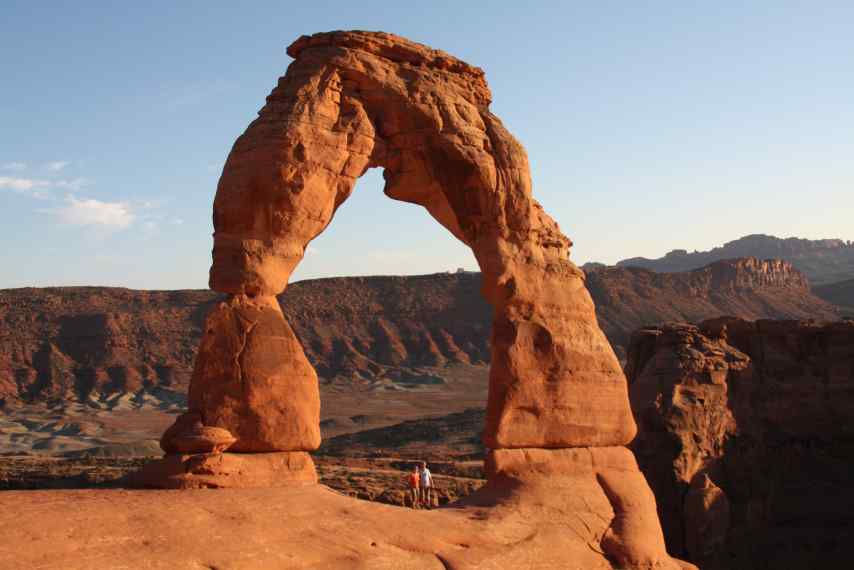 Arches
Nationalpark, Utah, USA: Der ultimative Sandsteinbogen des
Delicate Arch ziert nahezu jedes Prospekt über den Westen der
USA und ist sicher einer der bekanntesten Felsen der Welt.
Arches
Nationalpark, Utah, USA: Der ultimative Sandsteinbogen des
Delicate Arch ziert nahezu jedes Prospekt über den Westen der
USA und ist sicher einer der bekanntesten Felsen der Welt.
So macht Sandstein-Geologie Spaß: warm und
trocken, klare Sicht bis an die Kimmung. Nach einem
kleinen Spaziergang Happeningstimmung an einem der
schönsten Aussichtspunkte der Welt: der Delicate Arch,
links aufgenommen am 03.09.1994, rechts 13.09.2012 von
Johann THUT.
 Colorado River, Arizona, USA: Nahe
der Stadt Page kann man ein beeindruckenes Mäander des ca. 200
m tief eingeschnittenen Flusses Colorado sehen,
Colorado River, Arizona, USA: Nahe
der Stadt Page kann man ein beeindruckenes Mäander des ca. 200
m tief eingeschnittenen Flusses Colorado sehen,
aufgenommen am 13.09.1994.
 Natural Bridges, USA: Auf einer für
amerikanischen Verhältnisse kleinen Fläche wurden von einem
Fluss in den Sandstein Brücken geschnitten, die bis zu 70 m
hoch sind,
Natural Bridges, USA: Auf einer für
amerikanischen Verhältnisse kleinen Fläche wurden von einem
Fluss in den Sandstein Brücken geschnitten, die bis zu 70 m
hoch sind,
aufgenommen am 14.05.1981.
 Canyon de Chelly, USA: Beeindruckende,
bis zu 300 m hohe Felswände und frei stehende Felsnadeln aus
Sandstein - mit den Resten der indianischen Bevölkerung,
Canyon de Chelly, USA: Beeindruckende,
bis zu 300 m hohe Felswände und frei stehende Felsnadeln aus
Sandstein - mit den Resten der indianischen Bevölkerung,
aufgenommen am 17.09.1994.
- Orkney-Inseln, Großbritannien: Die Felsnadel des "Old Man
of Hoy" ist ein Sandstein.

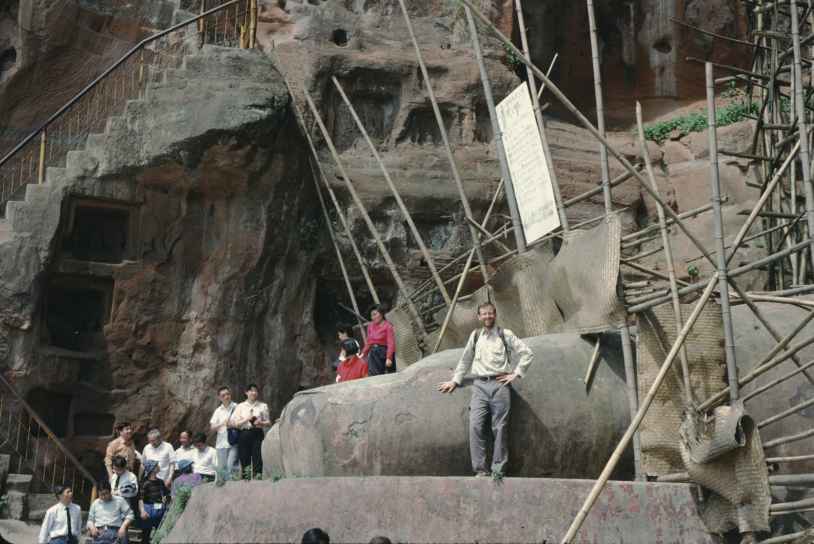 Leshan, Sichuanm, China: Der
Große Buddha von Leshan ist die größte Statue eines Buddha aus
(Sand)Stein. Der Bau wurde im Jahr 713 (Tang-Dynastie)
begonnen. Die Skulptur ist 71 m hoch und an den Schultern 28 m
breit; man beachte die Menschen auf dem Bild, rechts am Fuß,
Leshan, Sichuanm, China: Der
Große Buddha von Leshan ist die größte Statue eines Buddha aus
(Sand)Stein. Der Bau wurde im Jahr 713 (Tang-Dynastie)
begonnen. Die Skulptur ist 71 m hoch und an den Schultern 28 m
breit; man beachte die Menschen auf dem Bild, rechts am Fuß,
aufgenommen am 16.05.1991.
- Tassili National-Park, Algerien: In der schwer
zugänglichen Gegend befindet sich die wohl größte Ansammlung
an Bögen aus Sandstein.
- Petra, Jordanien: Die berühmte Stadt mit der oft
gezeigten Kirche wurde von den Nabatäern in den Sandstein
gehauen.
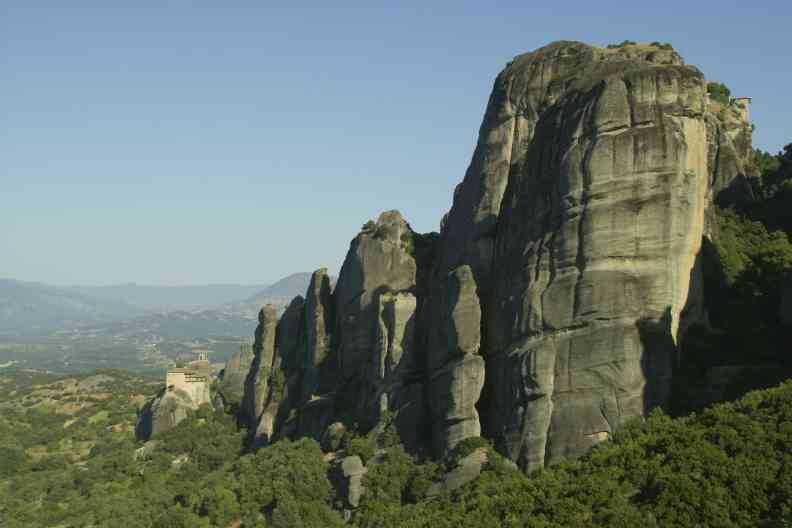 Meteora, Griechenland: Die berühmten Klöster stehen auf
den rundlichen Sandstein-Felsen ohne Vegetation, teils von
mächtigen Konglomeraten durchsetzt,
Meteora, Griechenland: Die berühmten Klöster stehen auf
den rundlichen Sandstein-Felsen ohne Vegetation, teils von
mächtigen Konglomeraten durchsetzt,
aufgenommen am 19.07.2011.
- Rondane, Norwegen: Die rundlichen Berge aus Sandsteinen
sind lagebedingt glazial überprägt worden.
 Pyhä-Luosto National Park, Finnland: Hier stehen helle
Sandsteine mit Wellenrippeln an, die das unglaubliche Alter
von 2 Milliarden Jahren aufweisen, so dass es mit die ältesten
Sandsteine überhaupt sind;
Pyhä-Luosto National Park, Finnland: Hier stehen helle
Sandsteine mit Wellenrippeln an, die das unglaubliche Alter
von 2 Milliarden Jahren aufweisen, so dass es mit die ältesten
Sandsteine überhaupt sind;
aufgenommem am 30.07.1987.

 Elbsandsteingebirge, Sachsen, Deutschland: Die berühmten
Felsen der Bestei und andere sind - wie der Namen sagt -
Sandsteine, ebenso die Mesas wie der Lilienstein. Es handelt
sich um kreidezeitliche Sandsteine,
Elbsandsteingebirge, Sachsen, Deutschland: Die berühmten
Felsen der Bestei und andere sind - wie der Namen sagt -
Sandsteine, ebenso die Mesas wie der Lilienstein. Es handelt
sich um kreidezeitliche Sandsteine,
links, aufgenommen am 13.06.1992,
rechts am 03.07.2019.
 Der etwa 14 m
hohe "Teufelstisch" bei Hinterweidenthal aus dem Buntsandstein
des Pfälzer Walds. Der Felsen ist auf dem Titel des Buchs von
Martin SCHWARZBACH "Europäische Stätten geologischer
Forschung" von 1976 abgedruckt,
Der etwa 14 m
hohe "Teufelstisch" bei Hinterweidenthal aus dem Buntsandstein
des Pfälzer Walds. Der Felsen ist auf dem Titel des Buchs von
Martin SCHWARZBACH "Europäische Stätten geologischer
Forschung" von 1976 abgedruckt,
aufgenommen am 06.04.1980.
- Helgoland, Nordsee, Deutschland: Der Felsen der "langen
Anna" ist ebenso ein Sandstein des Buntsandstein wie der im
Spessart.
 Die bis zu 1.230 m hohen Felsbuckel des
Monserrat etwa 45 nordwestlich von Barcelona in Katalonien
(Spanien) bestehen auch aus oiligozänen Sandsteinen und
Konglomeraten mit kalkigem Bindemittel. Aufgenommen am
17.05.1989 nach einem Brand, der das Buschwerk an den
Bergflanken schwärzte.
Die bis zu 1.230 m hohen Felsbuckel des
Monserrat etwa 45 nordwestlich von Barcelona in Katalonien
(Spanien) bestehen auch aus oiligozänen Sandsteinen und
Konglomeraten mit kalkigem Bindemittel. Aufgenommen am
17.05.1989 nach einem Brand, der das Buschwerk an den
Bergflanken schwärzte.
 Sandsteine aus dem Rotliegenden sind im
Spessart nicht aufgeschlossen, aber in der nahen Wetterau:
Steinbruch unterhalb des Schlosses Naumburg bei Heldenbergen.
Teile der Steine in der angewitterten Umfassungsmauer des
Schlosses stammen aus diesem Steinbruch. Neben schräg
geschichteten, groben Sandsteinen sind feinsandig-tonige Lagen
mit kohligen Zonen und Konglomerate zu sehen; aufgenommen am
23.03.2020.
Sandsteine aus dem Rotliegenden sind im
Spessart nicht aufgeschlossen, aber in der nahen Wetterau:
Steinbruch unterhalb des Schlosses Naumburg bei Heldenbergen.
Teile der Steine in der angewitterten Umfassungsmauer des
Schlosses stammen aus diesem Steinbruch. Neben schräg
geschichteten, groben Sandsteinen sind feinsandig-tonige Lagen
mit kohligen Zonen und Konglomerate zu sehen; aufgenommen am
23.03.2020.
Wäre das Klima bei uns arid, so wäre das ein Gestein, welches
hübsche Formationen bilden würde.
 Auch die berühmte Stadt
Petra in Jordanien ist in einem rötlichen Sandstein angelegt
worden. Der als Ram-Sandstein benannte Formation ist
kambrischen Alters und hat als Sandstein eine maximale
Mächtigkeit von etwa 300 m. Hier im Bild überformen
anthropogene Fo;
Auch die berühmte Stadt
Petra in Jordanien ist in einem rötlichen Sandstein angelegt
worden. Der als Ram-Sandstein benannte Formation ist
kambrischen Alters und hat als Sandstein eine maximale
Mächtigkeit von etwa 300 m. Hier im Bild überformen
anthropogene Fo;
aufgenommem am 23.09.2023 von Franz BILLER.
- ...
Sandsteine sind damit faszinierende Felsbildner. Hinzu kommen
bis vor kurzem noch recht unverstandene Merkwürdigkeiten, dass
so stabile - weil Quarz-haltige Gesteine - unter geeigneten
Bedingungen der Tropen so löslich sind, dass es sogar Höhlen
darin gibt!
Vorausgesetzt, wir hätten ein dauerhaft arides oder semiarides
Klima, dann hätten wir im Spessart sicher auch Felstürme,
Schluchten und spektakuläre Erosionsformen. Derzeit verhindert
die üppige Vegetation eine schnellere Erosion.
Wie kein anderes Gestein hat der Sandstein des Buntsandsteins den
Spessart geprägt: Waldbau, Formenschatz der Berge und Täler,
Werkstein, Glasmacher, Steinbrüche, Arbeitgeber für die Steinhauer
des Mittelalters bis ins 20. Jahrhundert bis hin zum Sand in den
Kies- und Sandgruben der Niederungen. Der "Miltenberger Sandstein"
("Mainsandstein") wurde als geschätzter Baustein sogar ins
europäische Ausland exportiert!

Sandstein mit farblich abgesetzter Bänderung und
Schrägschichtung;
Steinbruch der Fa. Wassum, Miltenberg
Historisches:
Der Name Buntsandstein steht für den ältester Abschnitt der Trias,
dessen Name auf Friedrich von ALBERTI (1795-1878) zurück
geht. Gleichzeitig versteht man darunter den Sandstein aus den
gleichen Zeit in Deutschland.
Im Spessart wird der leicht zu bearbeitende Sandstein mindestens
seit römischer Zeit zur Werksteingewinnung abgebaut.Im
Verbreitungsgbiet gab es früher in jedem Ort mind. einen
Steinbruch in dem man für den örtlichen Bedarf die Bausteine
gewann. Hunderte solcher Abbaue und Steinbrüche sind inzwischen
von der Vegetation zurück erobert worden und meist nur noch schwer
erkennbar. Die Entwicklung erreichte sicher an der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Heute stehen nur noch sehr
wenige Steinbrüche im Abbau (z. B. die Firmen Wassum in
Miltenberg; das seit ca. 100 Jahren bestehende Natursteinwerk
bricht ca. 5.000 m³ Fels pro Jahr und Fa. Zeller betriebt mehrere
Steinbrüche im Mainsandstein und verarbeiten diesen zu
vielfältigen Bausteinen).
MEIDINGER (1841:7) berichtet, dass jährlich 30.000 Schiffsladungen
des Miltenberger Sandsteins auf dem Main transportiert werden,
davon das Meiste flussabwärts.
Man errichtete insbesondere im 19. und anfangs des 20.
Jahrhunderts nahezu alle öffentlichen Bauwerke wie Brücken,
Schulen, Bahnhöfe, Forstgebäude, Schlösser und Burgen, Kirchen,
aber auch Stützmauern, Fundamente der Häuser, Treppen und
Fenstereinfassungen aus dem leicht zu bearbeitenden Baustoff. Auch
Mühlsteine, Tröge, Tränken und sehr viele Skulpturen (Bildstöcke,
Feldkreuze, Grenzsteine, ...) wurden daraus gefertigt. Aus dem
Sand des Buntsandsteins gewann man den Quarz als Rohstoff der
vielen Glashütten im Spessart. Der Sand aus dem Sandstein diente
an vielen Stellen geschürft als Scheuersand für die Dielenböden
der Vergangenheit.
Sandstein-Bildergalerie:

Fenster an der Kirche in Oberbessenbach. Der Sandstein
stammt aus dem örtlichen Steinbruch, der heute als
Klettergarten Verwendung findet,
aufgenommen am 24.05.2003.
|

Bildstock zwischen Alzenau und Kälberau,
aufgenommen am 01.05.2005 |
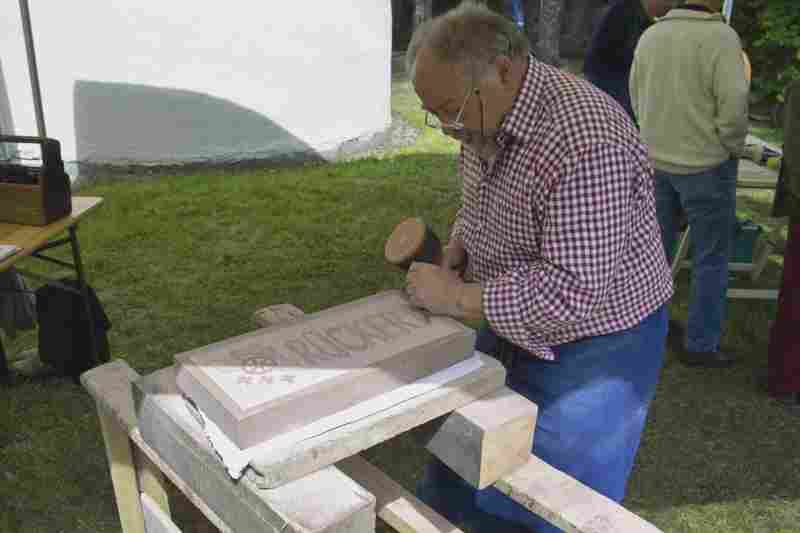
Der Steinmetz Reiner GROSSMANN aus
Haibach beim Bearbeiten eines Buntsandsteinstückes am
16.05.2005 in Rothenbuch anlässlich 10 Jahre
kurfürstliches Schlosshotel Rothenbuch.
|
|
Kilometer-Stein aus dem Buntsandstein
(Heigenbrücker Sandstein) zwischen Vormwald und
Engländer,
aufgenommen am 30.04.2005.
|

Uralte Treppe aus dem Sandstein von
Eichelsbach,
aufgenommen am 21.01.2012.
|

Taufe (16. Jahrhundert) aus Mainsandstein in der Kirche
St. Jakobus in Großauheim,
aufgenommen am 15.09.2012.
|

Die Schnecke aus Mainsandstein am oberen Ende der Treppe
zur Empore im Senckenberg-Museum in Frankfurt a. Main,
wohl ein Symbol für die Mühen des Aufstiegs,
aufgenommen am 13.01.2013.
|

Der stark mit Brombeeren verwachsene und seit langem
auflässige Steinbruch im Heigenbrückener Sandstein
(Unterer Buntsandstein) auf dem Gipfel des Findbergs bei
Haibach,
aufgenommen am 21.01.2012.
Der Sandstein wurde auch bis nach Aschaffenburg und über
den Main dann auch mainabwärts verkauft.
Achtung:
Der gesamte Weg zum Steinbruch ist mit dem sehr
dauerhaften Diorit-Schotter von Dörrmorbach befestigt!
|

Typische Spaltenfüllung aus gelblichem bis weißlichem
Calcit in kleinen skalenoedrischen Kristallen. Solche
Stücke wurden Anfang der 1970er Jahren in großen Massen in
einem alten Steinbruch südlich von Obernburg gefunden,
Bildbreite 14 cm.
|

Harald ROSMANITZ von Ärchäologischen Spessartprojekt
erklärt den Besuchern die Funktion der
mittelalterlichen Fernstraße am 07.07.2012. Die
Birkenhainer Straßen nahe dem Kloster Einsiedel
zwischen Lohrhaupten und Rieneck wurde bis auf den
felsigen Untergrund des hier anstehenden Mittleren
Buntsandsteins (Volpriehausen-Formation) ausgefahren, so
dass ein Hohlweg entstand. Durch die Befahrung mit
eisernen Rädern schnitt sich die Spurbreite in den Fels
und übermittelte eine Spurbreite von 1,05 m. Der Weg
verfiel und ist nur noch als Graben im Wald
erkennbar.
|

Teilnehmer einer Wanderung durch die Seltenbach-Schlucht
bei Klingenberg am 15.07.2012.
Das Kerbtal weist einige felsige Stellen auf, an denen der
Mittlere Buntsandstein angesehen werden kann. Das Tal ist
im oberen Teil sicher mittelalterlich überprägt worden, so
dass die steilen, V-förmigen Talflanken sehr jung sind.
Die Wanderung war vom LBV organisiert worden, der das
ehemalige Gelände des Tonbergwerks pflegen will.
|

Ehemaliges Elektrizitätswerk von Großauheim (Hanau),
heute Museum mit Dampfmaschinen, die mit echtem
Wasserdampf betrieben werden können! Das Gebäude besteht
in Teilen aus dem Plattensandstein (stellenweise gegen das
Lager eingebaut) mit dem Schriftzug des Jugendstils,
aufgenommen am 15.09.2012.
|

Bauplastiken aus Mainsandstein von einem Kaufmannshaus in
Mainz um 1317 einer mittelrheinischen oder mainzer
Werkstatt, ausgestellt im Landesmuseum in Mainz,
aufgenommen am 17.07.1012.
|

Das Schloss in Mainz mit den Ausstellungsräumen des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Das Gebäude wurde aus
"Mainsandstein" erbaut. Dies ist aber nicht sichtbar, da
man die Fassade überstrichen har, so dass man die Farbe,
aber nicht die Struktur des Sandsteins sehen kann. Nur
dort wo die Farbe oder der Stein bröckelt, ist die Natur
des Steins sichbar, aufgenommen
am 17.07.2012.
|

Typisches Schadbild am Heigenbrückener Sandstein an der
Kirche in Heigenbrücken durch aufsteigendes Wasser im
Porenraum des Sandsteins,
aufgenommen am 01.05.2013.
|

Typisch im Aussehen ist die Sandsteinfassade aus
Mainsandstein am Ärztehaus neben dem Hauptbahnhof in
Aschaffenburg,
aufgenommen in der Morgensonne am 25.07.2012.
|

Etwa 4 mm breite Wurmspuren (oder vielleicht auch
Krebsspuren) in der Schichtfläche eines großen
Sandsteinblocks, aufgenommen am 25.08.2012 südlich von
Röllbach, unmittelbar südlich des Eselsweg gelegen.
|

Tongalle mit einem Entfärbungssaum im Sandstein eines
Maingerölls, gefunden am 20.05.1971 in der Kiesgrube
Schulz zwischen Dettingen und Kleinostheim,
Bildbreite 2 cm.
|

Zwischen dem Hauptbahnhof von Berlin und dem Bundestag
quert die Willy-Brandt-Straße (früher Moltkestr.) über die
Moltkebrücke die Spree. Sie wurde nach einem Vorgängerbau
an gleicher Stelle 1886 - 91 aus rotem Mainsandstein
erbaut. Als Herkunft des Buntsandsteins werden
Kleinheubach, Kreuzwertheim und Dietenhan angeführt. Der
rote Sandstein weist zahlreiche Beschädi-
gungen aus dem 2. Weltkrieg auf,
aufgenommen am 15.02.2013.
|

Namenschild der Moltke-Brücke über die Spree in Berlin mit
den Gebäuden der Bundesregierung in Berlin im Hintergrund,
aufgenommen am 15.02.2013.
|

Das durch die Deutsche Bank genutzte, 1899 errichtete
Gebäude an der Straße Unter den Linden Nr. 13 hat eine
üppig ornamentale Fassade mit Balkonen und Säulen aus
rotem Mainsandstein (Rötsandstein). Infolge der
Leuchtenmaste und der Bäume in geringer Entfernung vor dem
Gebäude ist die Fassade auch im Winter ohne das Laub nicht
gut zu sehen. Es fällt zwischen den anderen Bauwerken
durch den dunklen Stein auf. Der untere Teil der Fassade
ist mit einer Farbe überstrichen,
aufgenommen am 15.02.2013.
|

Ehemaliger Kalkofen, gemauert aus den Quadern des Oberen
Buntsandsteins. Der Schachtofen zeigt die Technik des
späten 18. oder des frühen 19. Jahrhunderts,wurde aber
nach den Berichten bis um 1920 unregelmäßig betrieben. Der
einzig erhaltene Ofen des Spessarts sollweiter ausgegraben
und erhalten werden,
aufgenommen am 07.05.2013.
|

Heunesäule (siehe weiter unten) am Main in Miltenberg -
durch die Bananenstauden ergibt sich ein südliches Flair.
Oben erkennt man noch die gegenüberliegend vorstehenden
Nocken für das Anschlagen zum Transport,
aufgenommen am 29.09.2012.
|

1948 ganz aus dem örtlichen Sandstein des Buntsandsteins
erbaut: Das kombinierte Rathaus mit Feuerwehrhaus in
Dornau,
aufgenommen am 09.05.2013.
|

Offenbach, Ludwigstraße (gegenüber der IHK): Hier steht
ein Jugenstiel-Doppelhaus aus dem lokalen Basalt erbaut.
Die Gesimse und Laibungen, an Ecken, Fenstern und an den
Erkern sind in Mainsandstein ausgeführt,
aufgenommen am 14.05.2013.
|

Wasserbecken aus Buntsandstein am Museum Papiermühle
Hormburg; man beachte das Pflaster aus Sandstein,
aufgenommen am 30.05.2013.
|

Hier schaut der steinerne "Lindwurm" aus der Sandsteinwand
der Gaststätte Wolzenkeller in Homburg (Gemeinde
Triefenstein) am Rand des Spessarts. Oben der Kopf, in der
Mitte etwas Bauch und des Schwanzende ist eine
Blumenschale,
aufgenommen am 30.05.2013.
|

Der Neubau des Kreiskrankenhauses in Wasserlos mit
einervorgehängten Fassade aus Sandstein, vermutlich aus
dem Spessart,
aufgenommen am 18.05.2013.
|

TRAFO-Haus aus Sandstein westlich von Eschau, nahe der
Straßenkreuzung an der Straße nach Streit,
aufgenommen am 20.04.2014.
|

Die Kapelle in Frohnhofen ist aus einem weißen Sandstein
erbaut, wie man ihn in Eichenberg gewann,
aufgenommen am 16.11.2013.
|

Zaun als Mauer aus Sandstein in Großwallstadt,
aufgenommen am 12.01.2014.
|

Zaun eines Hofes aus sehr großen Sandsteinquadern bei
Großwallstadt,
aufgenommen am 12.01.2014.
|

Im Gebäude aus Main-Sandstein an der Hafenstraße 7 im
Hafen von Hanau ist der Chemiekalien-Händler Stockmeier
untergebracht. Das Gebäude wurde um 1924 gebaut,
aufgenommen am 16.04.2014.
|

Ablauf aus Sandstein unter einer Fensterbank; dahinter war
der Spülstein, einst wohl auch aus Sandstein - aus der
Zeit, in der es keine Abflussrohre im Haus gab,
aufgenommen am 18.05.2013.
|

Typische Verwitterung des schlecht gebundenen Sandsteins
aus Weibersbrunn mit einem Einbau gegen das Lager (rechts
oben) und der Verwendung mit Portlandzementmörtel. Dies
führt zum Erhalt des Mörtels und zur Zerstörung des
Sandsteins, Rathaus Weibersbrunn,
aufgenommen am 18.06.2014.
|

Im römischen Kastelle der Saalburg bei Bad Homburg stehen
7 römische Ältäre (6 hier zu sehen) aus dem Unteren
Buntsandstein (vermutlich aus dem Sandstein von
Obernburg), gefunden im Römerkastell von Stockstadt am
Main,
aufgenommen am 20.06.2014.
|

Miltenberger Sandstein mit Netzleisten als Denkmal auf
einem Kreisel der Umgehungsstraße von Faulbach,
aufgenommen am 05.07.2014.
|

Calcit-Kristalle und Calcit als "Zement" einer
Sandstein-Brekzie aus dem Steinbruch im Oberen
Buntsandstein bei Wüstenzell, gefunden vor 1980,
Bildbreite 10 cm.
|

Netzleisten und Spuren ehemaliger Steinsalzkristalle im
Volpriehausen-Basis-Sandstein in der Mauer der
Zehntscheune in Bad Soden-Salmünster. In den Mauern sind
weiter zu sehen: Dendriten, Rippelmarken, Konglomerate und
Verwitterungsbildungen,
aufgenommen am 16.10.2014
In dem Gebäude firmiert die Kletter-Spezial-Einheit, ein
Unternehmen welches Industrie-Kletterer beschäftigt und
einen Laden nebst Versandhandel betreibt.
|

Nachbau einer Gussform für Bronze, ausgestellt im Museum
Steinheim a. Main.
Ich denke, dass das nicht gut funktioniert, denn man
müsste die Form bei so dünnwandigen Objekten erheblich
vorwärmen und dafür ist der Sandstein nicht geeignet,
aufgenommen am 19.10.2014.
Trotzdem sind sind aus archäologischen Funden zahlreiche
Bronzegussformen gefunden worden.
|

Bis über 30 kg schwere Blidenkugeln, meist aus
Sandstein,im Museum Miltenberg, hergestellt zwischen dem
13. und 16. Jahrhundert,
aufgenommen am 23.01.2015.
|

Wasserleitungsrohre aus Sandstein von der Mildenburg,
zurecht gehauen im 13. Jahrhundert,
aufgenommen am 23.01.2015.
|

Die Alte Schule in Hofstetten: Salzausblühungen im
Sockelbereich mit starken Absandungen und
Rückverwitterung,
aufgenommen am 14.05.2015.
|

Ein Nadelkissen aus Sandstein - gesehen in der
Ausstellung"Steinreich Buntsandstein in Wertheim und
Umgebung" am 25.07.2015 im Grafschaftsmuseum in Wertheim
am Main.
|

"Baum der Hoffnung" des Künstlers R. M. SEILER aus einem
Mosaik aus dem Sandstein Klingenbergs, aufgenommen am
01.01.2016
|

Grenzstein aus Sandstein mit der Nr. 31 aus dem Jahr 1618
zwischen dem gemeindefreien Gebiet Aschaffenburgs und
Volkersbrunn im Hohewart-Wald,
aufgenommen am 26.03.2016.
|

"Willkommen in Karlstein" - zusammen mit blauen Fröschen
auf einem Sandsteinblock im Innern des Kreisels an der B8
zwischen Kahl und Großwelzheim (Gemeinde Karlstein),
aufgenommen am 07.09.2016.
Da es nach Meinung des Bayerischen Innenminsteriums eine
Erhöhung der Verletzungsgefahr bei einem Überfahren des
Kreisels darstellt, musste der Fels und die Spitzhacke
wieder entfernt werden! (Main-Echo vom 7.4.2017). Es ist
schon erstaunlich, um was sich ein Ministerium aus München
alles kümmert. Mit dem gleichen Argument kann man jede
Verkehrsinsel oder Ampel ablehnen oder alle Bäume am
Straßenrand entfernen. Oder die vielen neuen Einbauten in
der Straße
an Ortseinfahrten, die Blumenkübel, Verkehrsinseln zur
"Verlangsamung" des Verkehrs!
|

Originell und schwer wie Stein: Rucksäcke und Handtaschen
aus dem Sandstein aus der A3-Baustelle bei Waldaschff,
hergestellt von C. BECK aus Kleinostheim. Gesehen auf dem
LBV-Gelände zwischen Dettingen und
Kleinostheim am 25.06.2017.
|

Die Laurentiuskapelle mit Friedhof aus dem 14. Jahrhundert
und darauf zahlreicher Altgräber mit Grab-steinen aus
Sandstein, die die Kunstfertigkeit der Steinbearbeitung in
Miltenberg dokumentiert,
aufgenommen am 26.08.2017.
|

Überlebensgroße Sandsteinskulptur von 2018 am Schloss in
Rothenbuch, die den berühmten Wilderer Johann Adam
HASENSTAB (*21.09.1716 in Rothenbuch †3.6.1773
bei Schollbrunn) zeigen soll. Die grobe Plastik wurde von
Marc RAMMELMÜLLER geschaffen.
Aufgenommen am 22.07.2018.
|

Mühlstein aus dem Plattensandstein zwischen Zaunpfosten
ebenfalls aus Sandstein im Park der Kartause Grünau im
südöstlichen Spessart. Randlich sind Platten aus hellenm
Flint eingesetzt, die die Abriebfestigkeit des Mühlsteins
erheblich verbessern;
aufgenommen am 28.07.2018.
|

Steinmetzzeichen in einem Türstock aus den Mauern des
ehemaligen Klosters der Kartause Grünau,
aufgenommen am 28.07.2018.
|

Sandstein als origineller Wegweiser zum Bussig nördlich
von Großheubach. Die Halde des ehemaligenSteinbruchs ist
mit einer Schutzhütte ausgestattet und von hier hat man
einen der schönsten Ausblicke auf das Maintal bis nach
Miltenberg und Amorbach.
Hinweis:
In dem alten Steinbruch suchen Bürger aus dem Ort nach
Calcit in Sinterform in den Spalten des Sandsteins.
|

Staustall bei Großheubach; ein Pferch aus dem hier
anstehenden Sandstein für die Sauen in der Waldweide des
19. Jahrhunderts, als der Sauhirt noch die Schweine in den
Wald trieb, die sich hier das Futter selbst suchen
mussten, besonders wenn die Buchen (Bucheckern) und Eichen
(Eicheln) Mastjahre hatten.
Aufgenommen zur Erstbegehung des Kulturweges "Von Hecke zu
Häcke" am 04.11.2018.
|
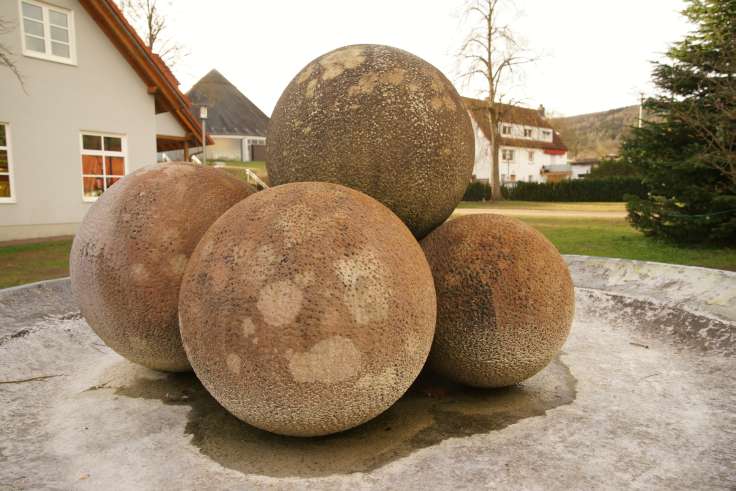
Der "Kugelbrunnen" im Ortszentrum von Wombach (Lohr) aus
Sandstein-Kugeln. Links der obersten Kugel lugt das Dach
der Kirche durch,
aufgenommen am 22.12.2018.
|

Das Kloster mit der Kirche in Neustadt am Main ist eine
karolingische Gründung (um 740). Im Vordergrund kann man
die Mauerreste aus dem örtlichen Sandstein und die mit
Folie abgedeckte Grabungsfläche sehen,
aufgenommen am 22.12.2018
Die Kirche im Hintergrund ist ebenfalls aus dem in der
Umgebung anstehenden Sandstein erbaut worden.
|

Einfacher Schleifstein aus einem Sandstein mit dem Antrieb
einer Handkurbel und ohne Schutz und Auflage vor dem
Eingang zum Heimat-Museum in Karlstein-Dettingen a. Main,
aufgenommen am 22.02.2019.
|

Brunnenhaus aus Sandstein an der Höhenstraße in Alsberg
(Ortsteil von Soden-Salmünster) im nordwestlichen
Spessart,
aufgenommen am 13.04.2019.
|

Ein Zaunpfosten aus Sandstein: Dauerhaft und leicht
herzustellen.
Gesehen in Miltenberg am 12.10.2019.
|

2019: Der Fund bei der Verlegung von Versorgungsleitungen:
Einem aufmerksamen Bürger in Meeholz ist es zu verdanken,
dassder Bildstock aus dem hier anstehenden Heigenbrückener
Sandstein nicht abgefahren wurde. Das von einem versierten
Steinmetz angefertigte Kunstwerk stammt wohl aus dem Jahr
1607. Ein Kunsthistoriker wird sich um den Stein und seine
Deutung bemühen,
aufgenommen am 09.02.2020.
|

Achtung: Täuschung!
Sieht aus wie ein Sandstein, ist aber keiner. Kunstfelsen
in einem Garten zwischen Wellpappe und Schule am Mühlweg
16 in Alzenau. Das Teil besteht aus Kunstharz und einem
Trägergewebe;
aufgenommen am 04.07.2020
|

Die Umgegungsstraße in Obernau wurde mit Gabionen
gegenüber der Wohnbebauung abgeteilt, die mit handgroßen
Schrotten aus Sandstein des Buntsandsteins gefüllt sind,
aufgenommen am 10.07.2020.
|

Die Felsfreistellung "Hunnenstein" am Kulturweg
Großheubach Route 2 "Über den Eselsweg zur Engelstaffel"
liegt auf dem Kamm südlich von Großheubach auf etwa 400 m
Höhe. Der örtliche Wanderverein hat in den 1920er Jahren
einen Aufstieg angebaut und die Bäume gerodet, so dass man
einen Blick auf Bürgstadt hatte. Der Wald ist zurück, so
dass es keinen Blick gibt. Die Erosionsformen sind durch
die menschlichen Aktivitäten so verändert, dass man nicht
mehr ermittel kann, ob es sich um (natürliche)
"Opferkessel" handelte.
Aufgenommen am 12.07.2020.
|

Die Heunschüssel südlich von Großheubach. Der im Sandstein
einetiefte Napf hate einen Durchmesser von etwa 40 cm und
ist etwa 8 cm tief. Man nennt solche
Verwitterungsbildungen "Opferkessel". Diese entstehen an
kleinen Vertiefungen im horizontal liegenden Sandstein,
wenn sich Wasser sammeln kann. Dieses löst und führt in
einer selbstverstärkenden Prozess aus Frost, Nässe und
Trocknen zu einer Vertiefung, bis wie hier der Fels
zerbricht und den Kreislauf enden lässt.
Aufgenommen am 12.07.2020.
|

Die wohl älteste erhaltene Verwendung von behauenen
Sandstein-Quadern am keltischen Ringwall des Schlossberges
südlich von Soden. Hier wurde nach einer archäologischen
Grabung 2009 ein Stück der Pfosten-Schlitz-Mauer wieder
aufgebaut, um dem Besucher einen realistischen Eindruck
von der gewaltigen Anlage zu vermitteln;
aufgenommen am 07.01.2021.
|
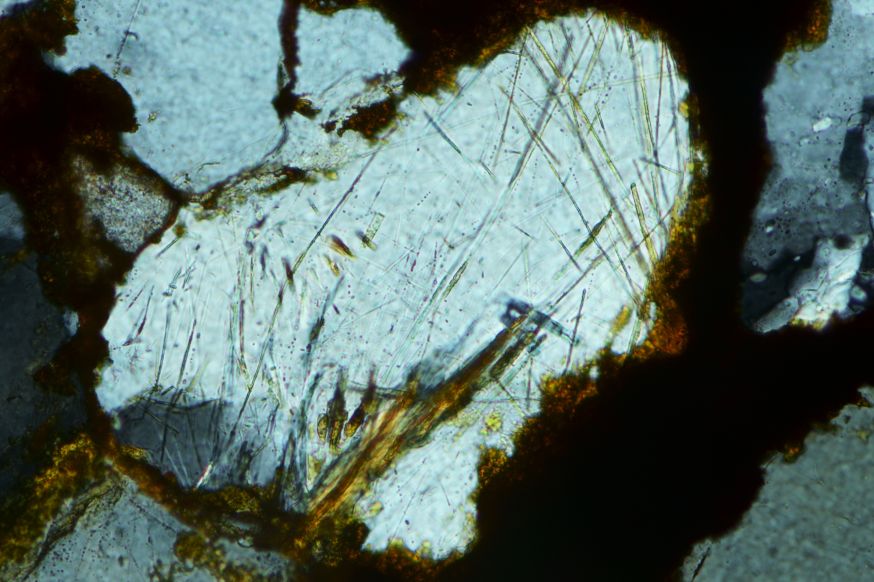
Bei der Untersuchung von Sandstein von Rohrbrunn aus dem
Buntsandstein (Volpriehausen-Formation) fiel ein kleines
Quarz-Korn auf, in dem kleine Amphibol-Nädelchen
eingeschlossen sind. Das Korn ist angelöst und umsäumt von
Illit und Goethit, Dünnschliff, Bildbreite 0,34 mm bei
gekreuzten Polarisatoren.
Daraus kann man schließen, dass das Quarz-Korn aus einem
Gebiet stammen muss, in dem metamorphe Gesteine vorkommen,
also zum Beispiel Erzgebirge, Fichtelgebirge, Oberpfälzer
und Bayerischer Wald, ...
|

Der weiße Sandstein vom Steinbruch an der Kuppe bei
Eichenberg,
aufgenommen am 18.02.2021.
|

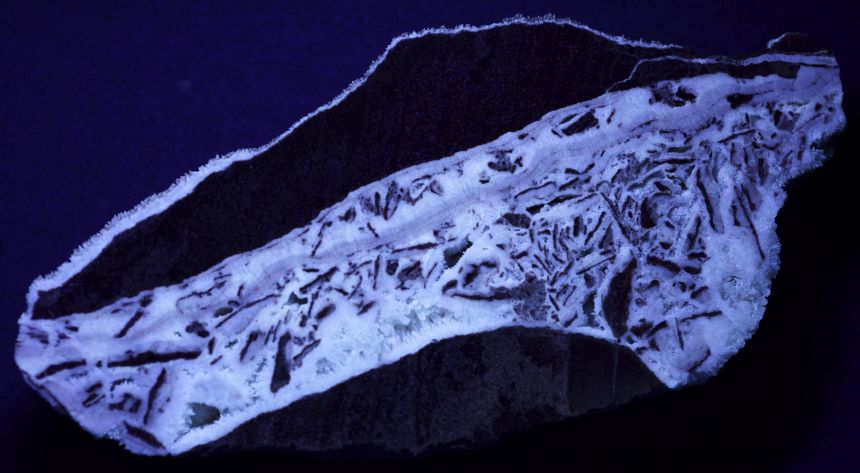
Calcit als Spaltenfüllung im Sandstein von Obernburg,
gefunden in den 1970er Jahren. Oben Tageslicht, unten
unter UV-Licht, Bildbreite 20 cm.
|

Einer der ältesten Grenzsteine im Spessart: Aus Sandstein
gehauen und aus dem Jahr 1559 erhalten. Der steht bei
Alsberg (Bad Soden-Salmünster) im nord-westlichen Spessart
und wurde mit einer Tafel des Kulturweges "Weitblick, Wald
& Wallfahrt" ausgerüstet. Das Foto stammt von der
Erstbegehung am 11.07.2021.
|

Ein Goldball mit einem Eichenblatt aus Sandstein vor dem
1972 gegründeten Golfplatz auf dem man seit 1988 auf 18
Bahnen spielen kann. Zum 25-jährigen Bestehen wurde das
Denkmal an der Zufahrt aufgestellt,
aufgenommen am 11.07.2021.
|

Der Sockel der ehemaligen Scheune des Hofguts Nilkheim
(Aschaffenburg) wurde beim Bau Ende des 18. Jahrhunderts
mit Sockelverblendsteinen aus Sandstein ausgerüstet. Dabei
hat man die rechteckigen Platten mit T-förmigen Ankern am
Plattenrand gesichert und mit Mörtel hinterfüllt;
aufgenommen am 17.08.2021.
|

Merkwürdiges Fossil im Sandstein; leider in einem sehr
großen Felsblock, der eine händische Bergung nicht
zuläasst. Der Steinkern(?) ist 40 cm hoch,
aufgenommen am 17.09.2021.
|

In der ehemaligen Marienkirche in Collenberg
(Reistenhausen) wurde eine Ausstellung zum Sandstein
(Buntsandstein) eingerichtet;
aufgenommen am 20.05.2022.
|

In der Ausstellung wird der Buntsandstein aus allen
Blickrichtungen thematisiert und sein Abbau und die
Verwendung in Zeitdokumenten dargestellt. Besucht am Tag
der Einweihung am 20.05.2022.
|

Eckquader in einer Mauer der Burg über Miltenberg - aber
nachgezeichnet und gerahmt, so dass man die eigentliche
Größe und Farbe der Steine nicht mehr sehen kann,
aufgenommen am 16.06.2022.
|

Natürliche Riefen an einem Sandsteingeröll, enstanden
durch die Verwitterung infolge unterschiedlicher Porosität
und Kornbindung. Gesehen am 03.02.2023 auf einer
Blockhalde in der Kiesgrube der Fa. Weber in Großostheim.
|

Taufbecken des 15. Jahrhunderts in der St.
Laurentius-Kirche in Bieber (Biebergemünd). Das frisch
restaurierte Becken ist aus dem hellen, lokalen
Heigenbrückener Sandstein hergestellt worden. Das
schlichte Becken befand sich über Jahrhunderte außerhalb
der Kirche und wurde im September 2023 auf einem neuen
Sockel wieder an den ursprünglichen Ort in der Kirche
zurück geführt;
Aufgenommen am 09.09.2023
|
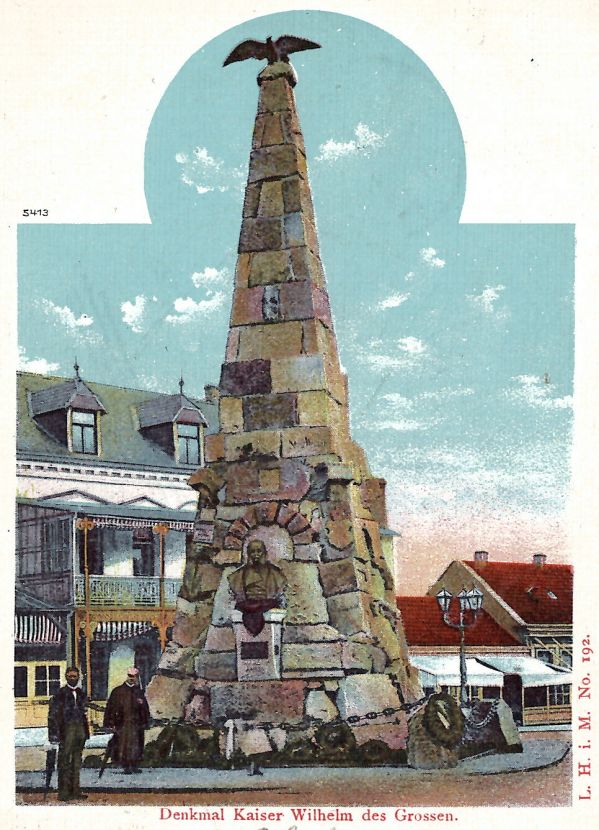
Denkmal zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. (*1797 †1888) in
Norderney von 1899. Dazu haben 75 Städte aus dem Deutschen
Reich Steine gestiftet, darunter auch Aschaffenburg mit
einem 5 t schweren Sandstein (BÄTJE 2002:12). Der aus
Aschaffenburg ist der dunkle Quader in der Mitte in Höhe
der Gauben am Gebäude links.
Wir man auf heutigen Fotos sehen kann, wurden im Laufe der
Jahre Veränderungen vorgenommen. Die gestifteten Rohsteine
wurden angepasst und dann in die Pyramide eingesetzt.
|

Das "Forsthaus" aus dem 18. Jahrhundert(?) am Schloss
Mespelbrunn ist aus dem örtlich anstehenden Sandstein der
Calvörde-Formation (oberer Heigenbrückener Sandstein bis
unterer Miltenberger Sandstein) erbaut. Dies gilt auch für
das Schloss selbst.
Keinesfalls wurde - wie die Führer erzählen - der
Sandstein aus Miltenberg angefahren, was im 16.
Jahrhundert aufgrund fehlender Straßen und
Transportmöglichkeiten (Fuhrwerke) auch für einen Echter
viel zu aufwändig und damit teuer gewesen wäre. Im Bild
sieht man, dass die Fugen im unteren Bereich nach
Feuchteschäden erneuert werden mussten;
aufgenommen am 11.05.2024.
|

Mitting gebrochener Sturz über einer Tür eines Hauses an
der Schlossstraße 7 in Steinbach bei Michelstadt im
Odenwald;
aufgenommen am 24.08.2024.
Der Bruch entstand, weil der Entlastungsbogen über dem
Sturz fehlt und der Druck durch die Mauer darüber den
"Sandsteinbalken" auf der Unterseite auf Zug beansprucht.
Sandstein ist druckfest - aber nicht zugfest, so dass bei
einer solchen Verwendung es zum Bruch kommt. Ein
Holzbalken würde hier nicht brechen, da Holz auch zugfest
ist.
In Steinbach gibt es einige weitere Beispiele für das
Fehlen von Entlastungsbögen über Stürzen.
|

Sandsteinquader in der Umfassungsmauer der Burg Breuburg
(Odenwald) aus dem 12. Jahrhundert (neben der ehemaligen
Zugbrücke), gefertigt aus dem hier anstehenden Unteren
Buntsandstein. Die über Jahrhunderte anhaltende, von der
Biologie unbeeinflusste Expostion nach Südosten hat zu
einer löchrig-kavernösen Verwitterung geführt, die man mit
dem Begriff Tafoni bezeichnet. Sie kommt bei uns an
natürlichen Felsen nicht vor, da Flechten und Moose solche
Flächen schnell besiedeln und damit diese
Verwitterungsform verhindern;
aufgenommen am 24.07.2024.
|

T-förmiges Kreuz in einer möglicherweise
"Wilgefortis-Darstellung" im Gewölbe des
Zelebrantensitzes, erstellt um 1445 in der Kirche St.
Hippolyt in Karlstein-Dettingen a. Main. Der
Main-Sandstein ist mit einer Farbe überstrichen, so dass
man nur an Beschädigungen erkennen kann, welcher Natur der
Stein ist. Dieses Kreuz fand seinen Niederschlag im Wappen
von Karlstein. Die Bildhauerarbeiten wurden vermutlich von
der Frankfurter Bauhütte am Dom erstellt;
aufgenommen am 23.09.2024.
|

Der Eingang der "Zigeunerhöhle" (so genannt in einem
historischen Riss aus dem Jahr 1791) im Heppdieler
Kirchenwald, nahe den in den heutigen Karten genannten
"Schwarzen Steins", wohl der markanten Felsbank oberhalb
im Wald. Es handelt sich um Felsen des Mittleren
Buntsandsteins am Südosthang des Rödeltals südöstlich von
Heppdiel (Gemeinde Eichenbühl). Die Höhle wird durch eine
fast meterdicke Felsbank gebildet, die als natürlich
abgerutscht angesehen werden kann, so dass sich eine Höhle
mit dreieckigem Querschnitt bildet; hier mit Joachim
LORENZ als Maßstab. Im Innern ist eine Bank mit einer
gemauerten Feuerstelle zu sehen, die teilweise verschüttet
ist;
aufgenommen am 30.11.2024.
|
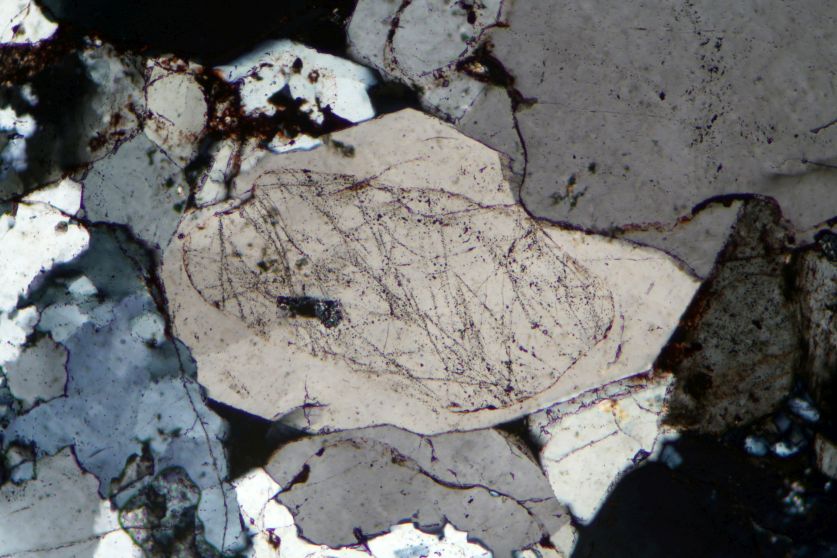
Sandstein vom Lufthof bei Dorfprozelten aus der Grabung
des ASP. Dabei handelt es sich um einen groben Sandstein
der Bernburg-Formation (Tonlagen-Sandstein), also das
oberste des Unteren Buntsandsteins. Der sehr poröse
Sandstein glitzert auf den Bruchflächen. Die Ursache sind
die orientierte Fortwachsungen der runden Quarzkörner, wie
das Bild oben zeigt. Das runde ehemalige Sandkorn ist von
linienförmigen Fluideinschlüssen durchzogen, die in der
Anwachszone fehlen. Der Anwachssaum ist von geraden
Kristallflächen begrenzt.
Dünnschliff unter polarisiertem Licht und gekreuzten
Polarisatoren und einer Bildbreite von 1,42 mm.
|

Die Kirche St. Katharina in Ernstkirchen (Schöllkrippen)
aus dem 14. Jahrhundert ist in den tragenden Teilen aus
dem in der Nähe anstehenden Heigenbrückener Sandstein
erbaut. Dieser helle, gelbliche Sandstein mit zahlreichen
"Poren" lässt sich leicht bearbeiten und war auch später
ein gesuchter Baustein.
Die Sandsteine in der Kirche wurden modern rötlich
angestrichen und mit "Schlieren" versehen, um einen
rötlichen Mainsandstein nachzuahmen (das Taufbecken ist
aus Mainsandstein geschlagen worden)! Die Fungen sind
hellgrau übermalt, so dass man eine Struktur besser sehen
kann;
aufgenommen am 12.04.2025.
|

Ausschnitt aus einer schweren Fährtenplatte im Sandstein
von Richelbach (Gemeinde Neunkirchen) südlich von
Miltenberg, gefunden von Thomas ROSENBERGER. Das Besondere
daran sind die Abdrücke der Schuppenhaut des
saurierähnlichen Tieres erhalten; es ist die
eindrucksvollste Fährte eines Chirotheriums aus
Unterfranken. Da es sich um einen Zufallsfund handelt, ist
die genaue Fundlage in der Rötformation des Oberen
Buntsandsteins nicht bekannt. Nach der Auswertung eines
Dünnschliffs handelt es sich um den Rötquarzit.
Bildbreite 25 cm.
Der ungefähr 200 kg schwere Stein mit dem Spurenfossil
befindet sich derzeit im Römermuseum in Obernburg, wo es
thematisch völlig deplatziert ist. Die Mutmaßung, dass es
sich bei dem Fährtenverursacher um den mit einem
Rückensegel ausgestatten Arizonasaurus (KLEIN
2025:25) handeln könnte, ist schön spektakulär
darstellbar, aber sehr fraglich, weil unbewiesen.
aufgenommen am 27.05.2023.
|

Die Eckquader am Museum Karlstein (erbaut 1905) bestehen
aus Mainsandstein, der mit Farbe überstrichen wurde und
örtlich abblättert, so dass die typische Streifung
sichtbar wird;
aufgenommen am 31.05.2025.
|

Sockelbereich der Ludwigssäule am bergseitigen Ende der
Ludwigsallee in Aschaffenburg am Godelsberg. Sie wurde
1843 zu Ehren des bayerischen Königs LUDWIG I. aus dem
Heigenbrückener Sandstein errichtet, weil er
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanzierte;
aufgenommen am 14.07.2025.
|
|
|
Leider ist der hohe Anteil an Quarz in Sandstein bei der
trockenen Bearbeitung der Grund für die nur geringe
Lebenserwartung der "Steinhauer" (Steinmetze) des
Sandstein-Spessarts gewesen. Der lungengängige Feinanteil erzeugt
beim Menschen die gefürchtete Silikose (lokal als
"Steinhauerkrankheit" bezeichnet), die nach schleichendem Siechtum
und unbehandelt immer zum Tode führt. Dies gilt noch mehr und
schneller für die Kombination Rauchen und Steinbearbeitung. Aber
die geringen sonstigen Verdienstmöglichkeiten im Spessart ließen
oft keine andere Wahl.

Heunesäule aus Sandstein auf dem Marktplatz vor
dem Dom in Mainz,
aufgenommen am 01.09.2007
Die Heunensäule am Dom in Mainz soll über 1000 Jahre alt sein.
Auf den Mainzer Marktplatz gelangte die zu einem Denkmal mit
Bronze "verzierte" Buntsandsteinsäule erst aus Anlass des
1000jährigen Domjubiläums im Jahre 1975. Die senkrecht stehende
Säule wiegt ca. 16 Tonnen, ist 6,40 Meter hoch und hat einen
Durchmesser von 1,20 Meter. Am oberen Ende sind zwei
herausstehende Nocken zu sehen, die man für das sichere Anbringen
von Seilen stehen ließ. Die eindrucksvolle Säule stammt vom
Osthang des Bullauer Berges bei Miltenberg am Main, wo mehrere
solcher Säulen als "Heunensäulen" liegen. Hier an einem Felsenmeer
sollen im 17. Jahrhundert noch 14 Säulen gelegen haben. Man glaubt
dass sie für einen frühen Kirchenbau, vielleicht sogar in Mainz,
verwandt werden sollten. Weitere Säulen wurden nach Nürnberg und
München gebracht und dort aufgestellt.

Außenwand einer Scheune in Dörrmorsbach,
aufgenommen am 07.07.2012.
Sandsteine sind hervorragende Baustoffe, aber nicht alle
Sandsteine des Buntsandsteins im Spessart eignen sich zur
Errichtung dauerhafter Gebäude. Insbesondere bei der Vermauerung
mit kalkarmen Mörteln und Feuchte können erhebliche Absandungen
beobachtet werden, so dass der Mauerverband nicht mehr sicher
gestellt ist.
Die Sandsteine des Mittleren Buntsandsteins eignen sich nur
bedingt für eine Verwendung, weshalb es hier nur wenige
Steinbrüche gibt.
Denkmäler?
Bei der Restaurierung von denkmalgeschützten Gebäuden kann es zu
Schwierigkeiten kommen, dass man das originale Gestein (z. B.
Gelnhäuser Sandstein) nicht mehr kaufen kann, weil es nicht mehr
abgebaut wird und auch keine Steinbrüche mehr gibt (Basalt von
Hanau), in denen sich ein gleiches Gestein gewinnen ließe. Hier
gibt es die Möglichkeit, ein ähnliches Gesteine zu verwenden -
oder man baut in einem der alten Steinbrüche wieder Material ab -
dies würde die Geowisschaftler am meisten freuen. Eine Gewinnung
von einigen m³ Gestein ist in der Regel problemlos, wenn
Besitzverhältnisse und Zufahrten geklärt sind.
Mit der Suche nach einem gleichwertigen und akzeptablen Ersatz
wende man sich an die unten aufgeführten Firmen.
Geologie:
Ca. 75 % der Fläche des Spessarts werden vom Buntsandstein
überdeckt, nur der westliche Teil des Vorspassarts ist davon frei;
d. h. hier wurde er von der nach Osten rückschreitenden Erosion
abgeführt. Als markante Geländekante - meist mit Wald bestanden -
ist er Landschaftsbild leicht erkennbar. Infolge der
Nährstoffarmut werden die Bundsandsteinflächen tradionell mit
Waldbau genutzt:


Links: Blick auf Schöllkrippen mit dem Wald über dem
Buntsandsteins in der Bildmitte,
Rechts: der Mittlere Buntsandstein
zwischen Rohrbrunn und der Haseltalbrücke an der Autobahn A3
westlich von Bischbrunn - ein beeindruckender Aufschluss!

Beim Bau der neuen Trasse der Autobahn A3
zwischen Weibersbrunn und Waldaschaff wurden ab 2013 sehr
eindrucksvolle Aufschlüsse im obersten des Unteren
Buntsandsteins geschaffen. Diese waren nur kurzfristig, aber
jede Woche anders. Hier ist eine Verwerfung bei gleichzeitiger
Kippung der rechten Scholle zu sehen;
Aufgenommen am 06.07.2013.
Aus dem überlieferten Formenschatz kann man die Geschichte
rekonstruieren:
- Rippelmarken (Oszillationsrippelmarken, Zungenrippelmarken,
Interferenzrippelmarken, zusammengedrückte Rippelmarken, ....)
- Schrägschichtungen
- Strömungswülste
- Schleifspuren
- Gerölle (unterschiedliche Größen und Rundungsgrade)
- Netzleisten
- Dehnungsrisse
- Fossilien (sehr selten)
- Trockenrisse
- Steinsalzpseudomorphosen (besser Steinsalz-Kristall-Relikte)
- Carbonat-Pseudomorphosen
- Tongallen oder Tonfetzen
- Regentropfeneindrücke
- Regeneinschlagrippeln
- Frostabplatzungen
- Windschliff, Windkanter
- fossile Böden
- Verfärbungen
- Korngrößenspektren
- mineralogische Zusammensetzung des Sedimentes
- .....
Der Sandstein wurde zu einer Zeit gebildet (251 - 247 Millionen
Jahre), als das heutige Deutschland dort lag wo sich heute die
Sahara ausdehnt (ca. 20° nördlicher Breite)! Während der Trias
drifteten wir dann ca. 10° weiter nach Norden. Hier wurden unter
kontinentalen Bedingungen enorme Sandmassen mit einem nassen, aber
trotzdem ariden Umfeld abgelagert. Dazwischen gab es auch lokal
marine Phasen und Ablagerungen aus Stillwässern. Der grösste Teil
wurde von mehr oder minder periodisch laufenden Flüssen bewegt und
als Spendergebirge wird das im Süden liegende Vindelizische
Hochland angenommen. Gröbere Anteile repräsentieren Schichtfluten
wie auch häufig eine eine Sortierung der Korngrößen zu beobachten
ist (unten größere Körner und oben feineres Korn).

Dass es zu langen Trockenperioden kam, belegen die Trockenrisse
(Netzleisten) im Ton (siehe Bild oben, Bildbreite ca. 28 cm). In
diesem Falle wurde der Ton sanft von Sand überdeckt und beim
Spalten dann wieder frei gelegt (das Stück lag bereits lange im
Steinbruch, so dass der Ton bis auf Reste abgefallen ist. Die
hellen Punkte sind Flechten. Der Glanz enstand durch die Fixierung
der nur ca. 1 cm dicken Platte mit Kunststoff; gefunden im
Steinbruch Wassum, Miltenberg)
Dies betrifft auch die verbreiteten
Tongallen - diese erreichen 10 cm Größe. Deren Entstehung kann
man sich so vorstellen: Nach einer Überflutung wurde zurest der
Sand und später dann auch der Ton in den Stillwässern abgesetzt.
Nach dem Eintrocknen bildeten sich Risse und der Ton zerfiel in
blättrige Brocken. Beim Überfluten mit den nächsten Flut wurde
der Ton leicht abgerollt und im Sand neu fixiert. Dies erfolgte
aber so schnell, dass der Ton weder weich noch aufgelöst wurde.
Bei der heute angreifenden Verwitterung werden die Tongallen
zuerst ausgewaschen und hinterlassen dann die linsenförmigen
Hohlräume.

große Tongallen (teilweise ausgewaschen) im Sandstein, Miltenberg
Die Tonsteinablagerungen sind in den sich nicht bewegenden
Flußarmen und Restseen gebildet worden. Die Schrägschichtung sind
Rinnensedimente eines weit das Gelände überdeckenden, mäandernden
Flußsystems, welches das sich absenkende Germanische Becken von
Süden mit Sedimenten füllte. Wellenrippeln sind verbreitet
überliefert, Trockerisse selten und ganz selten
Steinsalzpseudomorphosen. Auch kugelförmige Konkretionen sind
schichtweise zu erkennen. Als Zeichen einer früheren Bodenbildung
wird der Karneol-Dolomit-Horizont gedeutet.
 konkretionäre Kugeln im Sandstein
(Spessart-Museum, Lohr am Main)
konkretionäre Kugeln im Sandstein
(Spessart-Museum, Lohr am Main)
An Fossilien sind selten Pflanzenreste und Abdrücke von Sauriern
(Chirotherium sp.) überliefert. Verbreiterter sind
Rollmarken und Grabgänge. Diese sind aber auch leicht mit den
Druckmarken zu verwechseln.
 Chirotherium-Fährte (Spessart-Museum,
Lohr am Main)
Chirotherium-Fährte (Spessart-Museum,
Lohr am Main)

Große Fährtenplatte aus dem Sandstein des Oberen Buntsandsteins am
Parkplatz
an der Straße zwischen Külsheim und Bronnbach
(GPS-Koordinaten N 49° 41,008´E 9° 31,542´)
aufgenommen am 18.12.2021
Auch wenn es nicht mehr der klassische Spessart ist, aber bei
Külsheim (westlich von Tauberbischofsheim) gibt es einen
geologisch-naturkundlichen Wanderweg von 5,5 km Länge. An einem
Parkplatz, ca. 2 km nördlich des Ortes an der Straße nach
Bronnbach, wurde unter einem kleinen Dach eine ca. 5 x 2 m große
Sandsteinplatte aus dem Plattensandstein (Oberer Buntsandstein)
aufgestellt, die ca. 20 Fußabdrücke des Chirotherium spec.
beinhaltet. Das Alter des Gesteins liegt bei etwa 247 Millionen
Jahre. Der große Stein wurde am 21.09.1991 von Walter DIETZ aus
Külsheim entdeckt. Vermutlich wurde sie beim Bau der Straße
1860/62 frei gelegt, aber damals nicht beachtet. 1992 konnte der
einige Tonnen schwere Fels geborgen und an die jetzige Stelle
gebracht werden. Die Platte wurde im September 2021 von
Wissenschaftlern des Staatlichen Museums für Naturkunde in
Stuttagart neu untersucht, der Stein geschützt und die Eindrücke
farblich hervorgehoben. Eine rechts angebrachte Tafel hilft bei
der Interpretation zwischen den Abdrücken und dem einstigen
Verursacher der Fährten. Über einen QR-Code können weitere Infos
abgerufen werden.
Die Seltenheit der Fossilien, die geringen Abbaumengen und der
maschinelle Abbau macht Fossilfunde nahezu unwahrscheinlich.
Der Buntsandstein des Spessarts besteht meist aus fein- bis
grobkörnigen Sandsteinen mit tonigen, eisenhalten oder gar
quarzitischen Bindemitteln. Das kann man im Dünnschliff besonders
gut sehen:

Das Dünnschlifffoto zeigt einen leicht eisenhaltigen Sandstein von
Obernburg,
der neben den eckigen Quarzkörnern auch noch angewitterte
Feldspäte enthält
(Bildbreite ca. 2 mm, #Polarisatoren)
Infolge der unterschiedlichen Bindungen der Körner ist der
Sandstein leicht zu bearbeiten - aber dann auch weniger
Verwitterungsresistent. Man kann das an den heute noch stehenden
Bauten gut sehen, dass insbesondere in dem ersten Meter über dem
Boden eine mehr oder minder starke Absandung erfolgt
(Tafonibildung). Aber auch Skulpturen in schattigen Standorten
können stark beschädigt sein.
Die einzelnen Lagen werden durch Tonsteinlagen unterbrochen (bis
zu 15 % der Schichtmächtigkeit). Man unterscheidet heute den
Unteren- (aus Gelnhausen- und Salmünster-Folge), Mittleren- (aus
Volpriehausen-, Detfurth-, Hardegsen- und Solling-Folge) und
Oberen Buntsandstein (aus Rötfolge). Die Einheitennamen wie
Miltenberger- und Heigenbrückener Sandstein haben heute nur noch
lokale Bedeutung. Die Mächtigkeiten und Fazies unterliegen starken
Schwankungen.

Der "Miltenberger Sandstein" (Calvörde-Formation) knapp unterhalb
der Bernburg-Formation im Steinbruch Aubach (Wanderer-Parkplatz)
ca. 900 SO von Wiesen an der Straße von Wiesen nach Frammersbach.
Der Steinbruch wurde dankenswerterweise im April 2012 vom Bewuchs
frei gestellt (durch Bayerische Biodiversitätstrategie, Main-Echo
vom 11. Mai 2012 S. 21), so dass man die Sandsteinwände wieder gut
sehen kann; (siehe Spessartführer
Aufschluss Nr. 133 S. 227, GPS-Koordinaten: N 50° 6,316´ E 9°
22,708´). Der Steinbruch war zumindest zeitweise bis 1928 im
Betrieb, meist im Winter.
aufgenommen am 01.05.2012
Die Mächtigkeit der Sandsteine liegt im zentralen Spessart bei
ca. 530 m und es ist damit die mächtigste Gesteinsabfolge in
Unterfranken! Der Name Buntsandstein ist im Spessart kaum
gerechtfertigt, da fast nur rote und gelbliche Farben vorkommen.
Die rote Farbe wird von einer sehr dünnen Ümhüllung der Sandkörner
mit dem Eisenoxid Hämatit verursacht. Stellenweise sind die
Feldspatanteile in weiße Tone verwittert, so dass auch lokal (z.
B. bei Eichenberg) weißliche Sandsteine vorkommen.

Auch so etwas gibt es: Ein Harnisch im Sandstein,
gefunden von Maria LINDNER bei Ebenheid, knapp südlich des
Spessarts,
Bildbreite 7 cm
Der Sandstein ist hier stark beansprucht und gestaffelt
verschoben, so dass rundliche Bruchstücke entstehen, die wegen der
Striemung als "Pflanzenfossilien" interpretiert werden könnten.
Aber es ist nur Sandstein. Die gestriemten Harnischflächen sind
überzigen von Muskovit-Schüppchen, Tonmineralien und
feinstschuppigem Hämatit, der dem Begutachter rote Finger erzeugt.
Dies zeigt, wie schwer eine sichere Ansprache von Gesteinen sein
können.

Im weitläufigen Steinbruch auf dem Gipfel der Nebelkappe bei
Großheubach wurde
der Plattensandstein (Röt-Formation des Oberen Buntsandsteins) in
zahlreichen,
kleinen Abbauen gewonnen und mit Fuhrwerken zum Main gefahren. Der
rote, plattig
absondernde Sandstein (Name!) weist zahlreiche silbrig glänzende
Muskovit-Schüppchen
auf. Die Mehrzahl der Abbau stammen aus der Zeit nach 1843 und der
Abbau ist seit
den 1960er Jahren eingestellt. Heute zeugen nur noch die Wege,
Halden und die
wenigen Felsen - von Pflanzen überwuchert - von einer lange
anhaltenden
Steingewinnung,
aufgenommen am 04.11.2018
Früheres Wohnhaus des Steinbruchbesitzers an
der Kuppe bei Eichenberg.
Das frei stehende Haus wurde aus dem hellen bis weißen Sandstein
gefertigt.
Die Geschichte des Buntsandsteins ist dem im Vergleich zu anderen
Gesteinen wenig attraktiven Sandstein nur schwer zu entlocken,
weshalb sich nur sehr wenige Geologen diesem Gestein verschrieben
haben. Das Gestein ist sehr gleichförmig, beinhaltet keine visuell
schönen Mineralien und es gibt nur wenige, gute Aufschlüsse trotz
des großen Verbreitungsgebietes.
Die anderen Gesteine - Muschelkalk und Keuper - die in die Trias
gehören, sind im Spessart bis auf einen Erosionsrest bei
Unterwittbach abgetragen worden.
Mineralien:
Der Buntsandstein äußerst arm an neugebildeten Mineralien.
Verbreitet ist nur Calcit, der als weiße bis braune Kristalle
(Skalenoeder) und Krusten in Spalten gebildet wurden. Weiter gibt
es dabei den Formenschatz wie in Tropfsteinhöhlen zu beobachten,
allerdings in sehr bescheidenem Umfang. Solche Bildung werden an
geeigneter Stelle noch heute gebildet (z. B. neben dem
Möbelgeschäft "Spilger" bei Obernburg, südlich von Obernburg oder
auch aus Steinbrüchen bei Weibersbrunn). Diese Calcite zeigen auch
eine sehr intensive gelbe bis rote Fluoreszenz und teilweise auch
eine Phosphoreszenz (Nachleuchten).
Verbreitet sind auch Eisen- und Manganerze als synsedimentäre
Bildungen lokal angereichert ("Eisensandsteinbank"). Diese
enthalten dann erdigen bis glaskopfartigen Goethit und schlecht
kristalline Manganoxide. Stellenweise versuchte man einen Abbau
der Erze, was sich jedoch aufgrund der geringen Fe-Gehalte kaum
lohnte.
Die verbreiteten Baryt-Gänge (auch Schwerspat genannt) im
Sandstein wurden viel später aus hydrothermalen Lösungen in den
Störungen ausgeschieden. Da sie bis in den Buntsandstein reichen,
wurden sie später gebildet. Heute geht man von einem jurassischen
bis kreidezeitlichen Alter aus. Die an vielen Stellen des
Spessarts bergbaulich genutzten Gangzüge mit den reichen
Schwerspat-Vorkommen von bis zu 5 m Mächtigkeit bestehen meist aus
weißem Baryt ohne eine größere Vielfalt an Begleitmineralien.
Von den einst vielen Steinbruchbetrieben um Miltenberg existieren
nur noch die Fa. Wassum und die Fa. Zeller.
Steinbruch der Fa.
Wassum, Miltenberg
1904 gründete der Straßenbauunternhemer Friedrich Wassum einen
Steinbruchbetrieb. Dieser wurde von Erich Wassum fortgeführt und
wird heute von Thomas Wassum geleitet. In dem treppenförmig
angelegten Steinbruch werden Werksteine gewonnen. Man bohrt
senkrecht nahe nebeneinander ab und sprengt die großen Blöcke
vorsichtig ab.

aufgenommen am 16.10.2004

aufgenommen am 03.07.2020
Im eigenen Betrieb erfolgt das Sägen und die weitere Zurichtung
zu den zahlreichen Produkten. Der Miltenberger Sandstein wird als
"Roter Mainsandstein" gehandelt. Man gewinnt in dem kleinen
Steinbruch nördlich von Miltenberg jährlich ca. 5.000 m³
Werkssandstein und stellt daraus Werksteine, Blockstufen,
Restaurierungs- und Bildhauerarbeiten, Bossenverblender, Fassaden-
und Fußbodenbeläge und Bruchsteine für die Gartengestaltung her.
Referenzobjekte sind beispielsweise: Obermainbrücke und der
Eiserne Steg in Frankfurt, die Erf-Brücke in Riedern, Bahnhof
Schöllkrippen, Fa. NUKEM in Alzenau, Schloss Maisenhausen, diverse
Kirchen, ....
Die braurote Farbe, die weißgraue Streifung und eine Pigmetierung
aus Eisenoxiden machen den besonderen Reiz des Sandsteins aus. Der
dickbankige Sandstein wird durch 2 Hauptkluftsysteme in klotzige
Quader gegliedert. Die braunen Tüpfel im Sandstein sind wohl
Pseudomorphosen von Eisenoxiden nach früheren Carbonaten (aus
diesem Grund wurde der Sandstein früher "Pseudomorphosensandstein"
genannt). Die bis zu 40 cm mächtigen, dünnplattigen
Zwischenschichten aus Tonsteinlagen sind stellenweise reich an
Muskovit. Stratigraphisch gehört der Miltenberger Sandstein heute
zur in die höchste Calvörde(-Gelnhausen)-Folge und in die tiefere
Bernburg(-Salmünster)-Folge.
Die Fa. Wassum, Miltenberger Natursteinwerk Peter Wassum
GmbH, Im Söhlig 9, 63897 Miltenberg, Tel.: 09371/2781 betreibt
neben dem Steinbruch eine Steinbearbeitung. Hier arbeiten derzeit
ca. 30 Menschen in allen Betriebsteilen.
Zum Besuch fahre man in Miltenberg in Richtung Klingenberg,
überquere am Bahnhof die Bahngleise und biege bei der nächsten
Straße rechts ab ins Industriegebiet "Nord". Hier folge man der
Beschilderung.

Im weitläufigen Betriebsgelände steht ein geschmackvoll
eingerichtetes Bürogebäude mit einem hübschen Ausstellungsraum, in
dem man den Sandstein in seiner vollen Schönheit anschauen kann.
Auf den Freiflächen werden die zugesägten und bearbeiteten
Steinblöcke gelagert.
Steinbruch der Fa. Franz
Zeller (Umpfenbach) in Kirschfurt:
Am 1.1.1890 wurde die die Fa. Franz Zeller gegründet (man feiert
2015 125-jähriges Firmenjubiläum); vorher war er Geschäftsführer
der Fa. Winterhelt in Miltenberg. 1892 unterstützen die Söhne
Ludwig und Edmund den Betrieb und man besaß 4 Steinbrüche und
Werkplätze in Bürgstadt und Miltenberg. In der Gründerzeit groß
geworden (vor dem 1. Weltkrieg waren durchschnittlich 300
Mitarbeiter angestellt), beschäftigte man 1926 130 Mitarbeiter. Ab
1953 leitete Ernst (Sohn von Ludwig) die Geschicke des
Unternehmens. 1963 trat Franz ZELLER in den Betrieb ein und führte
ihn bis 2009. Seit dieser Zeit leiten den Betrieb die Tochter
Martina ZELLER-BRAUN und der Steinmetz Dieter BRAUN.

aufgenommen am 01.08.2008
Die Fa. Zeller (Franz Zeller
KG Natursteinwerke, Eichenbühler Str. 11, 63930 Umpfenbach,
Tel. 09378/777) betreibt in der 5. Generation mit ca. 50
Mitarbeitern noch heute in der Region 8 Steinbrüche, von denen der
in Kirschfurt innerhalb des Spessarts liegt. Man stellt in einem
neuen Produktionswerk in Umpfingen bei Miltenberg daraus eine
große Vielfalt an Sandsteinprodukten her. Dies reicht von
Restaurationen für historische Gebäude bis hin zu
Fassadenelementen von Neubauten. Typische Arbeitsfelder sind
Brücken, Krankenhäuser, Kirchen, chemische Industrie, Sparkassen
und Banken, Villen, Einfriedigungen, Brunnen und Grabsteine.
Auch die Fa. Zeller wie Winterheld u. a. betrieb als Abbaumethode
zur Felsgewinnung das Unterhöhlen. Dabei wurde am Wandfuß eine bis
zu 2 m hohe Kerbe bis zu 10 m in den Fels geschlagen. Man ließ
dabei Pfeiler stehen und stützte mit Holstempeln zusätzlich ab.
Anschließend wurde mit Schwarzpulver diese Stützen weggesprengt,
so dass die bis zu 50 m hohen Wände einstürzten. Dieses Verfahren
führte infolge der nach "Gefühl" ausgelegten Sicherheiten zu
Unfällen.
Heute sind die Abbauwände bis zu 10 m hoch. Man bohrt senkrechte
Löcher in dichtem Abstand und sprengt dann die Blöcke ab. Auch
werden große Blöcke durch Abkeilen gewonnen. Die so gewonnen
Steine werden mittels Radlader, Bagger und Krane bewegt und dann
ins Werk nach Umpfenbach verfahren.
Der Steinbruch der Miltenberger
Industriewerk KG
Industriestraße 4, 63927 Bürgstadt, Tel: 09371/4005-0,
e-mail: info@miltenberger-industriewerk.de, wird auch von der Fa.
Zeller genutzt. Der sehr große Steinbruch liegt nahe des
Theresienhofs bei Kirschfurt.

Aufgenommen am 08.01.2008
Der nur wenig verwachsene Steinbruch Kirschfurt mit den schön
gebänderten Sandsteinen (nördliche Steinbruchwand im Januar 2008).
Früher wurden mit einer Anlage Schotter gebrochen, die mit
Schiffen auf dem Main abgefahren wurden. Es bestand Ende der
1970er Jahren eine Kapazität von ca. 400.000 t pro Jahr. Aufgrund
von geänderten Anforderungen an den Schotter für die Bahn musste
der Betrieb eingestellt werden.
Der hier gewonnene Sandstein wird als "Mainsandstein" bezeichnet.
Er wurde weit geliefert und man kann ihn beispielsweise in
folgenden Städten bewundern: Frankfurt, Wiesbaden, Mainz,
Karlsruhe, Freiburg, Dortmund, Hamburg, Chemnitz, Lübeck, Berlin,
Zürich, St. Petersburg, ...

Im Bild (Bildbreite ca 40 cm) oben sieht man kleine, weiße
Flecken. Dabei handelt es sich um Reduktionshöfe. Diese
entstanden, weil das färbende Eisenpigment im Sandstein
kugelförmig um ein Zentrum - oft aus einem Erzkörnchen -
weggeführt wurde. Der diesem zugrunde liegende Prozess ist bisher
kaum verstanden, da diese Höfe besonders in geologisch alten
Gesteinen ganz unterschiedlicher Art zu beobachten sind.


Im beeindruckenden Steinbruch Kirschfurt sind schön gezeichnete
Sandsteine weit verbreitet. Hier wechseln helle Partien mit wenig
Eisenoxiden mit sehr eisenreichen in schönder Schräg- und
Kreuzschichtung ab. Ein großer Teil der Färbungen ist
synsedimentär angelegt worden. Die großen, rotbraunen Tongallen
belegen eine fluvatile Genese des Sandsteins (die gezeigten Blöcke
wurden aus dem Produktionsprozess aussortiert). Insbesondere die
Toneinschlüsse wittern sehr schnell aus und hinterlassen Löcher,
die kaum ein Kunde in einer Fassade toleriert.
Aufgenommen am 03.09.2006
Die nicht zur Werksteingewinnung nutzbaren Steine und Felsen
werden vielfältig verarbeitet (hinter den Wörtern sind Prospekte
im PDF-Format hinterlegt):

Die Partien, die nicht zur Werksteingewinnung verwandt werden
können, gehen in den Gartenbau oder werden zu Schrotten gebrochen,
so dass man das bunte Gemisch aus unterschiedlich gefärbten Lagen
zur Füllung von Gabionen verwenden kann. Das Material wird im
Sand- und Kieswerk der Fa. Fritz Weber GmbH & Co. Miltenberger
Industriewerke KG in Bürgstatt gebrochen und ausgesiebt. Die Reste
werden dann zu einem scharfen, braunroten Brechsand aufgemahlen.
Aufgenommen am 21.02.2012
Die großen, alten und aufgelassenen Steinbrüche
sind nicht ganz ungefährlich. Am 28.03.2005 stürzte eine größere
Menge Gesteinbrocken bis zu einigen Tonnen Gewicht auf ein
Autohaus in Miltenberg (siehe Main-Echo vom 29.03.2005 auf
Heimat-Rundschau-Seite) und erzeugte hier Schäden. Anschließend
erfolgten umfangreiche Sicherungsmaßnahmen.
Reistenhausen, eine einst
berühmte Sandsteingemeinde am Main
(heute Ortsteil von Collenberg am Main)

An der Hauptstraße in
Reistenhausen: Sandsteinhäuser
aufgenommen am 25.04.2011
Hier schaut der Sandstein aus allen Mauern.
Hier lebten die die Steinbarone der Arnolds und Henchs.
Hier gibt es alte Steinbrüche.
Hier wurden die Steine am Main behauen und auf Schiffe verladen.

Baustein für 2 € zugunsten des Museums
Bildbreite 12 cm
Hier gibt es ein im Werden begriffenes Heimatmuseum:
Der Förderverein zur Erhaltung der Bildstöcke und historischen Werte
e. V. unterhält in einem Haus an der Brunnenstraße 27 (97903
Collenberg) ein Museum. Das Haus wurde als Donation von dem
"Steinbaraon" Venantius Arnold um 1940 als Kindergarten an die
Gemeinde vermacht. Im Jahr 2001 begann man mit der Einrichtung eines
lokalen Museums zum Erhalt der Historie. Bei dem in einfachem
Sandstein erreichtete Gebäudekomplex ist selbst das Hofplaster aus
Sandstein gelegt. Im Innern sind historische Bilder und Werkzeuge
der einstigen Steinhauerei ausgestellt.
Der Schwerpunkt ist sicher die handwerkliche Tradition des Ortes;
derzeit werden textile Erzeugnisse und Fertigkeiten gezeigt. Die
Öffnungszeiten (unregelmäßig) erfrage man bei der Gemeinde oder beim
Trägerverein.



Das Museum direkt an der Durchgangsstraße von Miltenberg nach
Kreuzwertheim (Kirschfurt nach Fechenbach),
aufgenommen am 25.04.2011
Wenn man Reistenhausen besucht, dann versäume man nicht, sich auch
den Friedhof mit vielen alten Grabsteinen aus Sandstein anzuschauen
- darunter sind viele Steinhauer. Dieser Friedhof liegt nur wenige
hundert Meter vom Museum entfernt am Hang.


Sandstein in Vollendung.
Das monumentale Grabmahl der Arnolds (links) und der "Friedhof" für
nicht mehr benötigte Grabsteine - außerhalb der Friedhofsmauer
(rechts)
aufgenommen am 25.04.2011
Der geologische Wanderweg
an der Grenze zwischen Schöllkrippener Gneis, Zechstein und
Buntsandstein:
Im Vorspessat, östlich von Schöllkrippen, wurde am Samstag, den
11. September 2010 der Kulturrundweg Schöllkrippen 2 "Streifzug
durch die Erdgeschichte" zusammen mit dem Spessartbund Ortsgruppe
Schöllkrippen eingeweiht. Unter reger Teilnahme von etwa 80
Besuchern aus der Umgbung* konnte im Anschluss der ca. 4 km lange
Weg bei schönem Wetter begangen werden; Erläuterungen gaben die
Herren Himmelsbach, Schlenke, Stühler und Lorenz. An der Strecke
wurden 7 große Tafeln aufgestellt, die die lokale Geologie im
regionalen Kontext darstellen. Der Weg fußt auf einem bereits vor
40 Jahren begründeten Lehrpfad von Dr. Gerhard Kampfmann; er ist
somit der älteste Lehrpfad des Spessarts.


Die Eröffnung des Rundweges fand bei ausgezeichnetem Wetter
und musikalischer Unterhaltung durch die Kahlgründer Sänger
statt. Der pyramidale Felsblock
links besteht aus dem Schöllkrippener Gneis. Rechts im Bild (von
links) Akkordeonspieler der Kahlgründer Sänger, Dr. Gerrit
HIMELSBACH, Frau HAIN, Bürgermeister
von Schöllkrippen Rainer PISTNER, stellvertrende Landrätin
Marianne KROHNEN, Dr. Walter MERGNER von den Bayerischen
Staatsforsten und Joachim LORENZ (Foto
Helga Lorenz).
Der Beginn ist entweder vom Naturschwimmbad oder vom Hof
Schabernack (Gaststätte; nahe an Vormwald) aus möglich. Der Weg
ist leicht begehbar; der größte Höhenunterschied führt zum
Standort der Alteburg, einer mittelalterlichen Motte. Entlang des
Weges passiert der Wanderer den Schöllkripper Gneis (anstehend und
als Felsblock), dann die Sedimente des Zechsteins (als
dunkelbraune bis schwarze Tonsteine und Dolomit, darin eingestreut
weißer Baryt (Schwerspat), einen
eindrucksvollen Steinbruch im Unteren Buntsandstein (auch
Heigenbrückener Sandstein, heute Calvörde-Formation genannt), ein
kleines "Felsenmeer" und die Wasseraufbereitung von Schöllkrippen
(Arsenproblematik). Das zugehörige blaue Faltblatt ist beim Archäologischen
Spessartprojekt, der Gemeinde Schöllkrippen und beim
Spessartbund Ortsgruppe Schöllkrippen erhältlich.

Die Teilnehmer der Schlussrunde während der Eröffnung
hatten spontan die Gelegenheit,
das Wasserwerk von Schöllkrippen auch von Innen anschauen zu
können. Der
Bürgermeister Rainer Pistner gab dazu ausführliche
Erläuterungen.
Dabei ist der Sandsteinbruch am Röderhof (unweit der Rodberghütte
des Spessartbundes) nach seiner Freistellung von den Bäumen durch
die Bayerische Staatsforsten unter der Leitung von Herrn Schlenke
besonders beeindruckend (als Geologe wünscht man sich aber, dass
die östliche Hälfte des Steinbruches auch noch vom Baumbewuchs
befreit wird). In der ca. 20 m hohen Felswand sind die typischen
Merkmale des Buntsandsteines erkennbar: Schrägschichtungen,
Tonklasten, Störungen und die sandige Verwitterung an der
Oberfläche. Infolge der vielen Klüften und losen Felsen kann man
nur davor warnen, ohne Schutzhelm an die stellenweise überhängende
Steinbruchswand zu gehen.

Die mächtige Felswand des Unteren Buntsandsteins im
Steinbruch am Röderhof
östlich von Schöllkrippen (Foto Helga Lorenz).
Die Wegführung durch auch außerhalb des Waldes eröffnet bei gutem
Wetter zahlreiche Fernblicke in den Kahlgrund und damit auch zu
anderen geologisch-mineralogischen Besonderheiten, wie z. B. zum Kalmus.

Über dem Kalmus erhebt sich der aus Quarziten und
Glimmerschiefern bestehende
Hahnenkamm (436 m), erkennbar an den Sendemasten.
*Die Schöllkrippener Bevölkerung hatte bis auf weinge Teilnehmer
keine Zeit, da gleichzeitig der Spessartbund Ortgruppe Schöllkrippen
auf eine 125jährige Geschichte zurück blicken konnte und dies an der
Rodberghütte gefeiert werden musste.
Am 13.10.2012 wurde in einem sehr familiären Kreis und in
Anwesenheit der Witwe, Kinder und Enkel von Dr. KAMPFMANN der
Geologische Rundweg mit einer Tafel auf Schöllkripper Gneis
ausgerüstget, die an den Spessartforscher aus Schöllkrippen erinnern
soll:


Die Redner Gerhard STÜHLER, Bürgermeister Rainer PISTNER, ein Enkel
von Gerhard KAMPFMANN, Dr. Dieter MOLLENHAUER und Dr. Gerrit
HIMMLSBACH würdigten das Lebenswerk des Forstdirektors Dr. Gerhard
KAMPFMANN (*8. Oktober 1923, †15. Mai 2012).
Römermuseum
Obernburg
Untere Wallstr. 14
Obernburg a. Main



Hier kann man römische Sandsteine anschauen:
Links: Eine bedeutende Sammlung von ca. 35 Weihesteinen aus
beschrifteten Sandsteinen der Benefiziarien, von denen aber nur
wenige ausgestellt sind.
Mitte: Der (Sand-)Stein mit der Inschrift zur Errichtung des
Kastells Obernburg (heute würde man vom Grundstein sprechen)
Rechts: Der Leiter des Museums, Dr. Leo Hefner, erläutert die
Bedeutung der Funde aus der obernburger Nekropole am Beispiel
eines Grabsteines aus Sandstein in einer Nachbildung des
eigentliches Grabes.
aufgenommen am 27.10.2008
Ein Teil der ausgestellten Steine wurden aus Kirchen und Mauern
gerettet (man hatte die behauenen Steine aus der römischen
Produktion weiter verwandt). Die Steine waren nach der Herstellung
in römischer Zeit weiß gekalkt worden, dann die Schrift farbig
hervorgehoben und der Stein schön bunt bemalt worden - also völlig
anders als heute.
Das kleine Museum zeigt im Gewölbekeller des Untergeschoßes einen
Mithraskult, im EG die Steine und im 1. Obergeschoß die Keramiken,
Münzen, Beschlagteile, Werkzeug, Glas und Neuerwerbungen.
Burg Partenstein
Ein eindrucksvolles Beispiel für die mittelalterliche Verwendung des
hier anstehenden Heigenbrücker Sandsteins ist die Burg Partenstein,
kanpp außerhalb und über dem Ort auf der Westseite auf einer
Bergschulter gelegen. Wie man aus den Funden weiß, war auch diese
Burg von ca. 30 x 20 m Größe im unteren Teil völlig aus dem
Sandstein erstellt. Die Steine waren aus den wenig behauenen oder
zugerichteten Steinen mit einem Kalkmörtel vermauert. Lediglich die
Ecken waren aus großen Bossenquadern gefertigt, die man aus den
dickeren Bänken herstellte.
Hier hat der örtliche Geschichts- und Burgverein Partenstein in
Zusammenarbeit mit der Archäologischen Spessartprojekt unter Leitung
von Harald Rosmanitz neben den Ausgrabungen auch eine
mittelalterliche Baustelle nachempfunden, so dass man sich eine
Vorstellung machen kann, wie man z. B. die Mauersteine mit einem
einfachen Kran angehoben hat. Das hölzerne Hebewerk wurde von einem
Tretrad angetrieben, in dem ein oder mehrere Menschen laufen
mussten. Zum jährlichen Burgfest wird die Funktion vorgeführt.

Das Tretrad mit einer Last aus Sandstein,
aufgenommen am 26.06.2011.
Burg Wildenstein

Die Doppeltoranlage im Zugang der Burg Wildenstein,
aufgenommen am 09.06.2012

Die Burg Wildenstein knapp oberhalb des gleichnamigen Ortes bei
Eschau ist vom Mittleren Buntsandstein (Volpriehausen-Wechselfolge)
umgeben und daraus erbaut. Davon zeugen die beiden Steinbrüche, die
gleichzeitig als Burggraben fungieren. Der Sandstein führt wenige
Tongallen. Die einzelnen Sandstein-Bänke sind durch Tonsteine
unterbrochen, die eine leichte Geinnung von Bausteinen ermöglichen.
Der graubraune Sandstein glitzert schön in der Sonne, ist also
kieselig gebunden, aber nur relativ schwach, so dass das Gestein nur
bedingt als Baustein geeignet ist, weil es bei einer Belastung
oberflächlich absandet.



Das Mauerwerk der Umfassungsmauer ist sorgfältig ausgeführt worden
und stammt etwa aus dem 13. Jahrhundert. Die Mauern des Palas
dagegen wurden nicht so sorgfältig hergestellt. Dabei sind die
einzelnen Steine nur ganz grob zugerichtet worden und auch nicht
satt in das Mörtelbett gelegt worden, so dass es Zwischenräume gab,
die der Belastung nicht stand hielten und so sind in den Mauern
zahlreiche Risse zu sehen, die aufgrund von Druckbelastung in der
Zugzone der Steine entstanden sind. Diese Risse sind sicher sehr alt
und haben sich wahrscheinlich bereits kurz nach dem Bau gebildet, da
die Kanten bereits genau so stark erodiert sind, wie die übrigen
Kanten der Bausteine. Die sicher nachträglich angebrachten
Stützmauern konnten diesen Fehler in der Bauausführung nicht
korrigieren. Die mittigen Zangenlöcher in den Quadern der
Umfassungsmauer stammen noch aus der Bauphase, wo man die Quader
mittels einer Zange und einem Kran an die Bestimmungstelle hob,
aufgenommen am 09.06.2012..

Ehemaliger Pallas: Das beeindruckende Gewölbe des Kellers ist sehr
sorgfältig aus ganz groben Steinen - nahezu mörtellos - gesetzt
worden, aufgenommen im Rahmen einer Führung durch den Archäologen
Harald Rosmanitz vom Archäologsichen Spessartprojekt beim Burgfest
am 09.06.2012.
Grafschaftsmuseum
Wertheim
Ausstellung "Steinreich - Buntsandstein in Wertheim und
Umgebung" 25. Juli 2015 - 14. Februar 2016:


Zur Eröffnung kamen ca. 75 Besucher in den Modersohnsaal, meist
Unterstützer, Leihgeber und Förderer des Grafschaftmuseums. Es
begrüßten der Oberbürgermeister Stefan MIKULICZ, die Kuratorin Frau
Ursula WEHNER und der Leiter des Museums Dr. Jörg PACZKOWSKI. In der
Einführung wurde berichtet, dass der Ausdruck "steinreich" seine
Wurzeln im Mittelalter hat, als der Normalbürger ein Fachwerkhaus
aus Holz und Lehm bauen konnte und nur ganz reiche Menschen ein Haus
aus Stein erbauen lassen konnten. Weiter erfuhren die Zuhörer, dass
ein Künstler beim Anblick der vielen Sandsteinbauten in Wertheim von
einem "Terra-pozzuoli-Farbton" des Sandsteins gesprochen hat.
Die Ausstellung im Keller bietet eine Kollektion aus Sandsteinen der
Umgebung von Bernd WOLZ, Werkzeuge der Steinhauer, alte Fotografien
der Belegschaften in den Steinbrüchen, dingliche Zeugnisse aus den
Familien und die sozialen Auswirkungen der Steingewinnung,
Literatur:
ADER, U. [Hrsg.] (2014): Die Aschaffenburger Meisterschüler und
ihr Schloss in der Zeit des Wiederaufbaus. Zeitdokumente
Erinnerungen Anekdoten.- 112 S., zahlreiche, meist SW-Abb.,
Repliken, Fachschule (Meisterschule) für Steinmetzen und
Steinbildhauer, [Druckerei und Verlag Valentin Bilz GmbH]
Goldbach.
ALBERTI, F. v. (1834): Beitrag zu einer Monographie des Bunten
Sandsteins, Muschelkalks und Keupers, und die Verbindung dieser
Gebilde zu einer Monographie.- ohne Abb., 366 S., 2 gefaltete
Tafeln in Umschlagklappe, [J. G. Cotta´schen
Buchhandlung]Stuttgart. Reprographischer Nachdruck von 1998 mit
einem Vorwort und einer Biographie (46 S.) im Anhang, Friedrich
Alberti-Stiftung der Hohenloher Muschelkalkwerke, Ingelfingen.
Anonym (1967): Bericht über die 88. Tagung des Oberrheinischen
Geologischen Vereins e. V. in Aschaffenburg.- Jahresberichte und
Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins N. F. 49,
S. 5 - 9, [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
ARNOLD, PETER A. M. (2015): Steinbarone. Historische
Familienerzählung. Eine Arnold Familiengeschichte.- 241 S., 8 S.
unpag. Anhang mit Fotos, [City-Druck Hirschberger]
Heidenheim.
Autorenkollektiv (1964): Erläuterungen zur Geologischen Karte von
Bayern 1:500000.- 2. Aufl., 343 S., München.
Autorenkollektiv (1996): Geologische Karte von Bayern 1:500000 mit
Erläuterungen.- 4. neubarbeitete Aufl., 329 S., 61 Abb., 21 Tab.,
8 Beil., [Bay. Geolog. Landesamt] München.
BACKHAUS, E. (1964): Zur Frage der Einwirkung des Pleistozäns auf
dem Buntsandstein in Odenwald und Spessart.- Zeitschrift der
Deutschen Geologischen Gesellschaft Band 116, 3. Teil, S.
984 - 985, Hannover, [Verl. F. Enke] Stuttgart.
BACKHAUS, E. (1967): Beiträge zur Geologie des Aschaffenburger
Raumes.- Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins
Aschaffenburg e. V. 10, 260 S., Aschaffenburg.
BACKHAUS, E. (1967): EXCURSIONSFÜHRER zur 88. JAHRESTAGUNG des
OBERRHEINISCHEN GEOLOGISCHEN VEREINS vom 28. März - 1. April 1967
in Aschaffenburg.- Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums
der Stadt Aschaffenburg, Heft 74, 113 S., Aschaffenburg.
BÄTJE, M. (2002): Tag des offenen Denkmals. Vom Fels zum Meer
Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf Norderney.- Archiv-Journal Extraausgabe
8.2.2002, 12 S., SW-Fotos, Hrsg. von der Stadt Norderney.
BAUEREISS, L. (1935): Die Steinhauererkrankungen des
Mainsandsteingebietes. Nach Untersuchungen an Kranken mit Silikose
der Würzburger Medizinischen Universitätsklinik.- 19 S., ohne
Abb., Inaugural-Dissertation der Hohen Medizinischen Fakultät der
Bayer. Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der
Medizinischen Doktorwürde, [Buchdruckerei Richard Mayr] Würzburg.
BERBERICH, L. (1990): 100 Jahre Franz Zeller Natursteinwerke 63897
Miltenberg.- Festschrift anlässlich der 100-Jahr-Feier am 14. und
15. September 1990, 48 S., 54 meist farb. Abb., [Caruna Druck]
Miltenberg.
BOCK, H., FREUDENBERGER, W., LEPPER, J., SCHMITT, P. & WEBER,
J. (2005): Der Buntsandstein in Main-Tauberfranken (Exkursion B am
31. März 2005).- Jahresberichte und Mitteilungen des
Oberrheininschen Geologischen Vereines Neue Folge Band 87,
S. 65 - 96, 18 Abb., 2 Tab., [E. Schweizerbart´sche
Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
CRAMER, P. & WEINELT, W. (1978): Geologische Karte von Bayern
1:25000 Erläuterungen zum Blatt Nr. 5922 Frammersbach.- 137 S.,
München.
Deutsche Stratigraphische Kommission [Hrsg.] (2013): Stratigraphie
von Deutschland XI, Buntsandstein.- Schriftenreihe der Deutschen
Gesellschaft für Geowissenschaften Heft 69, 657 S., sehr
viele meist farb. Abb. als Karten, Profile, Fotos und Zeichnungen,
1 farb. gefaltete geolog. Karte, 1 ausklappbare Profiltafel, [E.
Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
DIEDERICH, G. (1964): Zur Stratigraphie des Unteren Buntsandstein
im deutschen Buntsandsteinbecken.- Zeitschrift der Deutschen
Geologischen Gesellschaft Band 116, 3. Teil, S. 875 - 890,
2. Tab., Hannover, [Verl. F. Enke] Stuttgart.
DIEDERICH, G. & LAEMMLEN, M. (1969): Buntsandsteingliederung
in Bayern und Hessen.- Notitzblatt des Hessischen Landesamtes für
Bodenforschung zu Wiesbaden Bd. 97, S. 195 - 205, 1 Abb.,
Wiesbaden.
GATUINGT, L., ROSSANO, S., MERTZ, J.-D., FOURDRIN, C., ROZENBAUM,
O., LEMASSON, Q., REGUER, S., TRCERA, N. & LANSON, B. (2021):
Characterization and origin of the Mn-rich patinas formed on
Lunéville château sandstones.- Eurorean Jouranl of Mineralogy,
Volume 33, p. 687 - 702, 11 figs., 4 tab., [Copernicus
Publications] Göttingen.
GEYER, G. (2002): Geologie von Unterfranken und angrenzenden
Regionen.- Fränkische Landschaft Arbeiten zur Geolgraphie von
Franken Band 2, 588 S., 234 Abb., 5 Tab., 1 Geologische
Karte lose im Anhang, [Klett-Perthes] Gotha.
GEYER, G. & LORENZ, J. (2014): Quo vadis Buntsandstein?
Ungeahnte Fallstricke der Nomenklatur und Stratigraphie im
Spessart.- Jahresberichte der wetterauischen Gesellschaft für die
gesamte Naturkunde zu Hanau/gegr. 1808 163 - 164,
Themenband Spessart, S. 33 - 73, 22 Abb., Hanau.
HADERER, F.-O. (1997): Die Saurierfährten von Hardheim.- fossilien
14, S. 100 - 106, [Goldschneck Verl.] Korb.
HENNINGSEN, D. (1986): Einführung in die Geologie der
Bundesrepublik Deutschland.- 3. Aufl., 140 S., Stuttgart.
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)
[Hrsg.] (2021): Geologie von Hessen.- 705 S., mit 300 Abb., 2
Tafeln und 42 Tab., [Schweizerbart] Stuttgart.
JUNG, J. (1996): Die quartäre Aufarbeitung der
kretazo-tertiären Verwitterungsdecke im süd-westlichen
Buntsandstein-Spessart - dargestellt anhand einiger Hangprofile
bei Kleinwallstadt am Main.- unveröffentlichte Diplomarbeit der
Bayerischen Julius Miximilians Universität Würzburg Istitut für
Geographie, Teil I - Texband 128 S., Teil II - Anhang 58 S.,
Würzburg.
KELBER, K.-P. (1990): Die versunkene Pflanzenwelt aus den
Deltasümpfen Mainfrankens vor 230 Millionen Jahren.- Beringeria,
Sonderheft 1, 67 S., Würzburg.
KLEIN, H. (2025): Die Richelbacher Fährtenplatte.- 36 S., 16 Abb.,
[Logoverlag Eric Erfurth] Obernburg am Main.
KOWALCZYK, G. & PRÜFERT, J. (1978): Exkursion F in das
Oberrotliegende und den Zechstein am Rand von Spessart und
Vogelsberg am 1. April 1978.- Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver.,
N. F. 60, S. 87 - 108, 7 Abb., 1 Tab. Stuttgart.
LEPPER, J. (2004): 100 Jahre Wassum Miltenberger Natursteinwerk in
Miltenberg: Stein und Wein am Untermain.- Naturstein 6/2004, S.
54 - 57.
LORENZ, J. (2007): Der Buntsandstein - der Stein aus der Wüste.-
Nobless, Ausgabe 01/2007, S. 40 – 41, 8 Abb., [Media-Line@Service]
Aschaffenburg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 689ff, 774ff.
LORENZ, J., JUNG, J. & VÖLKER, A. (2022): Die Eisenerze des
Buntsandsteins im Spessart – Genese und die Quelle einer
mittelalterlichen Eisenverhüttung? Iron-ores in the Buntsandstein
Unit of the Spessart – Genesis and a Source of a Medieval
Ironworks?- in LORENZ, J. A. & der Naturwissenschaftliche
Verein Aschaffenburg [Hrsg.] (2022): Eisen & Mangan. Erze,
Konkretionen, Renn- und Hochöfen.- Nachrichten des
Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Band 112,
S. 9 – 40, 31 Abb., 2 Tab.
LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,
R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in
Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band
8, S. 65ff, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,
Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei
Joh. Walch] Augsburg.
MADER, D. (1985): Beiträge zur Genese des germanischen
Buntsandsteins. Entstehungmechanismen fluvatiler Ablagerungen als
Beispiele für die sedimentologische Erforschung kontinentaler
Rotserien.- 630 + X S., [Sedimo] Hannover.
MEIDINGER, H. (1841): Statistische Übersicht der Mainschifffahrt
und der Flößerei im Jahr 1840 nebst einigen Worten über Frankfurts
Handel der Vorzeit und seine Messen.- 230 S., mit einer Karte des
Mainstroms und des Main-Donau-Kanals, [Johann Valentin Meidinger]
Frankfurt am Main.
MURAWSKI, H. (1992): "Nur ein Stein" Geologie des Spessarts.- 308
S., 58 teils farb. Abb., Museen der Stadt Aschaffenburg.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
OKRUSCH, M. & WEINELT, W. (1965): Erläuterungen zur
Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5921
Schöllkrippen.- 327 S., 53 Abb., 10 Tab., 3 Beil. [Bayerisches
Geologisches Landesamt] München.
PRINZ-GRIMM, P. & GRIMM, INGEBORG (2002): Wetterau und
Mainebene.- Sammlung Geologischer Führer 93, 167 S., 50
Abb. u. 1 Tab. im Text, Exkursionrouten und 1 Tab. im Umschlag,
[Gebrüder Borntraeger] Berlin.
REINECK, H:-E. (1984): Aktuogeologie klastischer Sedimente.- 348
S., mit 250 Abbildungen und 12 Tab., [Verlag Waldemar Kramer]
Frankfurt am Main.
RÖDER, J. (1960): Toutonenstein und Heunesäulen bei
Miltenberg Ein Beitrag zur alten Steinindustrie am
Untermain.- Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte Heft 15,
32 Abb. im Text, 30 Tafeln im Anhang und 3 farb. Kartenbeilagen in
Umschlagtasche, [Verlag M. Lassleben] Kallmünz/Oberpf.
RUTTE, E. (1981): Bayerns Erdgeschichte. Der geologische Führer
durch Bayern.- 1. Aufl., 266 S., München.
SCHÄFER, A. (2005): Klastische Sedimente. Fazies und
Sequenzstratigraphie.- 414 S., zahlreiche Profile, Zeichnungen,
Karten, Tab., [Elsevier - Spektrum Akademischer Verlag] München.
SCHEINPFLUG, R. (1994): Als der Spessart Saurierland war. Im
Buntsandstein haben sich Spuren von Saurierarten erhalten: Von
Reptilien Fußabdrücke, von Amphibien wenige Knochenspuren.-
Spessart Heft 5/1994, S. 11 - 13, Aschaffenburg.
SCHMIDT, C., BUSCH, B. & HILGERS, C. (2021): Compaction and
cementation control on bleaching in Triassic fluvial red beds,
S-Germany.- Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für
Geowissenschaften (ZDGG) Volume 172 (4), p. 523 - 539, 11
figs., 1 suppl., [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung]
Stuttgart.
SCHMIDT, C., BUSCH, B. & HILGERS, C. (2021): Lateral
variations of detrial, authigenic and petrophysical properties in
an outcrop analog of the fluvial Plattensandstein, Lower Triassic,
Central S-Germany.- Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für
Geowissenschaften (ZDGG) Volume 172 (4), p. 541 - 564, 15
figs., 1 suppl., [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung]
Stuttgart.
SCHMITTNER, M. (1997): Steinbrucharbeiter haben mehr verdient als
die Beschäftigten anderer Wirtschaftszweige. Sie sind aber früher
gestorben.- Spessart 1997, Heft 8/1997, S. 3 - 12 [Main-Echo
Kirsch GmbH] Aschaffenburg.
STREIT, R. & WEINELT, W. (1971): Geologische Karte von Bayern
1:25000 Erläuterungen zum Blatt Nr. 6020 Aschaffenburg.- 398 S.,
52 Abb., 14 Tab., 5 Beilagen, Bayerisches Geologisches Landesamt,
München.
Subkommission Perm/Trias (1993): Beschlüsse zur Festlegung der
lithostatigraphischen Grenzen Zechstein/Buntsandstein/Muschelkalk
und zur Neubenennungen im Unteren Buntsandstein in der
Bundesrepublik Deutschland.- Z. angew. Geol. 39, S. 20 -
22, [Akademie] Berlin.
Subkommission Perm-Trias (SKPT) (2011): Beschlüsse der Deutschen
Stratigraphischn Kommission 1991 - 2010 zu Perm und Trias von
Mitteleuropa.- Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für
Geowissenschaften, Band 162, Heft 1, S. 1 - 18, 2 Abb., 4
Tab, [E. Schweizerbart´schen Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von
Bayern 1:25000 Blatt Nr.6021 Haibach.- 246 S., mit 41 Abb., 4 Tab,
2 Beilagen, Bayerisches Geol. Landesamt München.
WERNER, WOLFGANG, WITTENBRINK, JENS, BOCK, HELMUT
& KIMMIG, BIRGIT (2014): Naturwerksteine aus Baden-Württemberg
– Vorkommen, Beschaffenheit und Nutzung.- 765 S., 1.248 Abb., 45
Tab., herausgegeben vom Landesamt für Geologie und Bergbau,
Regierungspräsidium Freiburg. WITTMANN, O. (1972):
Geologische Karte von Bayern 1:25000 Erläuterungen zum Blatt Nr.
6022 Rothenbuch.- 102 S., München..
YOUNG, R. W., WRAY, R. A. L. & YOUNG, A. R. M. (2009):
Sandstone Landforms.- 304 p., einige SW-Abb., Diagramme und wenige
Tab., [Cambridge University Press] Cambridge UK

Ein Kerzenhalter aus Miltenberger Sandstein der Fa. Zeller,
Umpfenbach
hergestellt 2010.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite


 Flinders Range, Südaustralien: Hier
wurden in den präkambischen Sandsteinen die Fossilien der
Ediacara-Fauna gefunden, die zur Namenbildung des Ediacariums
(635 - 542 Millionen Jahren) führte.
Flinders Range, Südaustralien: Hier
wurden in den präkambischen Sandsteinen die Fossilien der
Ediacara-Fauna gefunden, die zur Namenbildung des Ediacariums
(635 - 542 Millionen Jahren) führte.  Monument Valley, Arizona, USA: Die sehr
markanten Inselberge in einer wüstenhaften Landschaft aus dem
De Chelly-Sandstein sind allen Rauchern und aus Westernfilmen
bekannt,
Monument Valley, Arizona, USA: Die sehr
markanten Inselberge in einer wüstenhaften Landschaft aus dem
De Chelly-Sandstein sind allen Rauchern und aus Westernfilmen
bekannt, 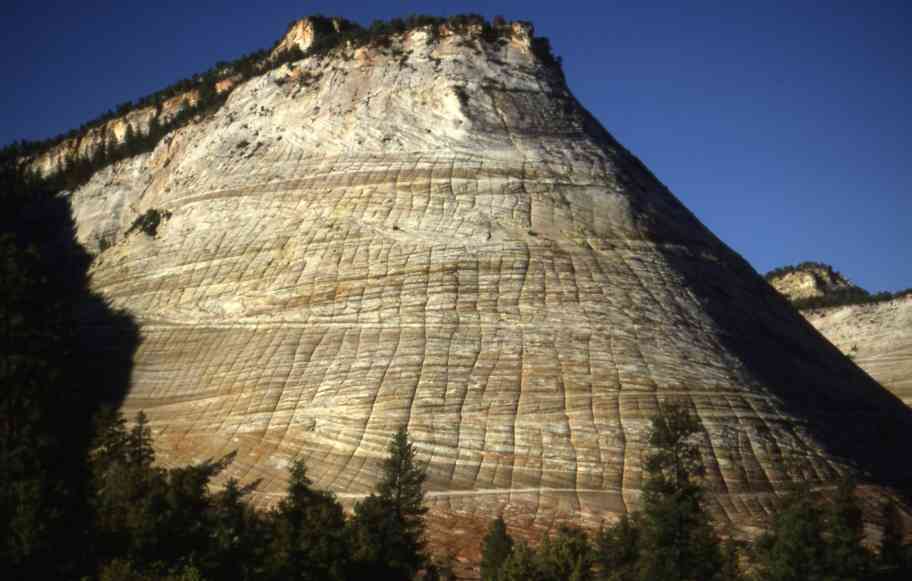 Checkerboard-Mesa aus einem Sandstein
mit Kreuzschichtung im Zion Canyon, Utah, USA: Die Schluchten
der Narrows und der riesigen Felswände des Zion Canyons
bestehen aus dickbankigen Navajo-Sandsteinen,
Checkerboard-Mesa aus einem Sandstein
mit Kreuzschichtung im Zion Canyon, Utah, USA: Die Schluchten
der Narrows und der riesigen Felswände des Zion Canyons
bestehen aus dickbankigen Navajo-Sandsteinen,  Grand Canyon,
Arizona, USA: Ein Teil der hohen Felsbänke wird aus sehr
widerstandfähigen Coconino-Sandsteinen aufgebaut, die wohl
großartigste Landschaft der Welt,
Grand Canyon,
Arizona, USA: Ein Teil der hohen Felsbänke wird aus sehr
widerstandfähigen Coconino-Sandsteinen aufgebaut, die wohl
großartigste Landschaft der Welt,  Antelope-Canyon bei Page, Arizona, USA: Die
farbenprächtigen, "gebogenen" und selektiv beleuchteten
Schichten des kleinen Canyons sind das Ziel von Fotographen
aus aller Welt,
Antelope-Canyon bei Page, Arizona, USA: Die
farbenprächtigen, "gebogenen" und selektiv beleuchteten
Schichten des kleinen Canyons sind das Ziel von Fotographen
aus aller Welt, 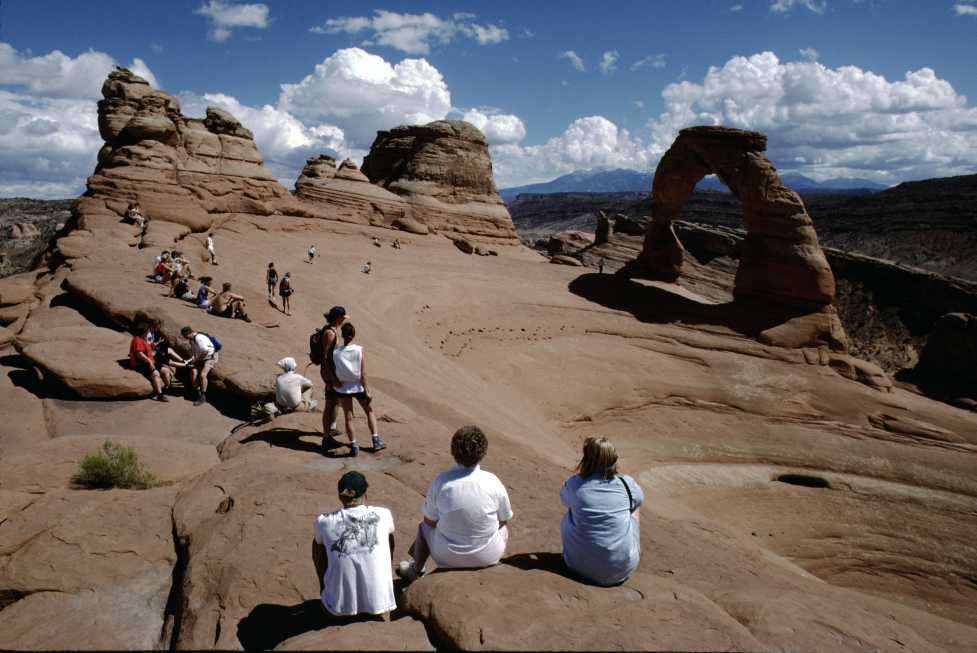
 Colorado River, Arizona, USA: Nahe
der Stadt Page kann man ein beeindruckenes Mäander des ca. 200
m tief eingeschnittenen Flusses Colorado sehen,
Colorado River, Arizona, USA: Nahe
der Stadt Page kann man ein beeindruckenes Mäander des ca. 200
m tief eingeschnittenen Flusses Colorado sehen,  Natural Bridges, USA: Auf einer für
amerikanischen Verhältnisse kleinen Fläche wurden von einem
Fluss in den Sandstein Brücken geschnitten, die bis zu 70 m
hoch sind,
Natural Bridges, USA: Auf einer für
amerikanischen Verhältnisse kleinen Fläche wurden von einem
Fluss in den Sandstein Brücken geschnitten, die bis zu 70 m
hoch sind,  Canyon de Chelly, USA: Beeindruckende,
bis zu 300 m hohe Felswände und frei stehende Felsnadeln aus
Sandstein - mit den Resten der indianischen Bevölkerung,
Canyon de Chelly, USA: Beeindruckende,
bis zu 300 m hohe Felswände und frei stehende Felsnadeln aus
Sandstein - mit den Resten der indianischen Bevölkerung, 
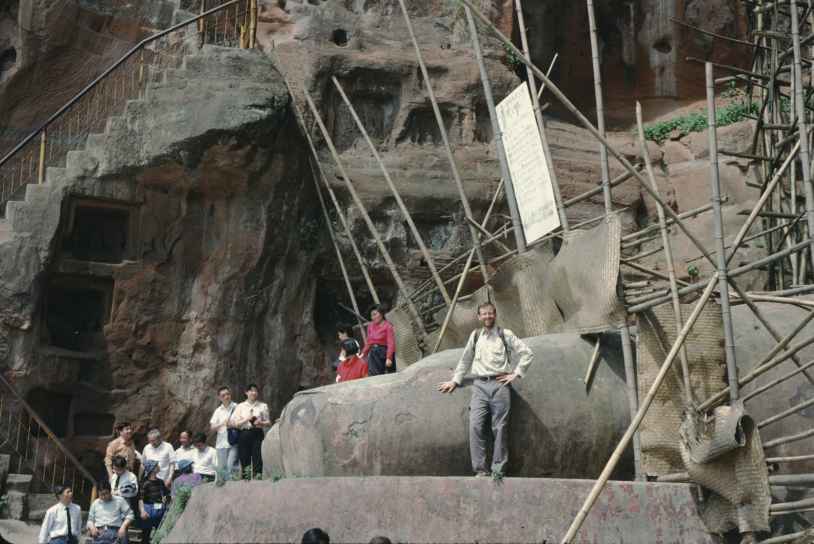 Leshan, Sichuanm, China: Der
Große Buddha von Leshan ist die größte Statue eines Buddha aus
(Sand)Stein. Der Bau wurde im Jahr 713 (Tang-Dynastie)
begonnen. Die Skulptur ist 71 m hoch und an den Schultern 28 m
breit; man beachte die Menschen auf dem Bild, rechts am Fuß,
Leshan, Sichuanm, China: Der
Große Buddha von Leshan ist die größte Statue eines Buddha aus
(Sand)Stein. Der Bau wurde im Jahr 713 (Tang-Dynastie)
begonnen. Die Skulptur ist 71 m hoch und an den Schultern 28 m
breit; man beachte die Menschen auf dem Bild, rechts am Fuß, 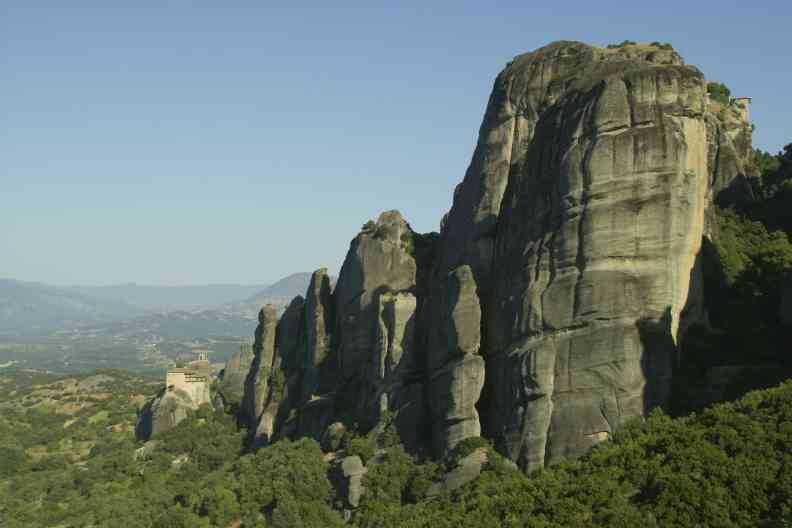 Meteora, Griechenland: Die berühmten Klöster stehen auf
den rundlichen Sandstein-Felsen ohne Vegetation, teils von
mächtigen Konglomeraten durchsetzt,
Meteora, Griechenland: Die berühmten Klöster stehen auf
den rundlichen Sandstein-Felsen ohne Vegetation, teils von
mächtigen Konglomeraten durchsetzt,  Pyhä-Luosto National Park, Finnland: Hier stehen helle
Sandsteine mit Wellenrippeln an, die das unglaubliche Alter
von 2 Milliarden Jahren aufweisen, so dass es mit die ältesten
Sandsteine überhaupt sind;
Pyhä-Luosto National Park, Finnland: Hier stehen helle
Sandsteine mit Wellenrippeln an, die das unglaubliche Alter
von 2 Milliarden Jahren aufweisen, so dass es mit die ältesten
Sandsteine überhaupt sind; 
 Der etwa 14 m
hohe "Teufelstisch" bei Hinterweidenthal aus dem Buntsandstein
des Pfälzer Walds. Der Felsen ist auf dem Titel des Buchs von
Martin SCHWARZBACH "Europäische Stätten geologischer
Forschung" von 1976 abgedruckt,
Der etwa 14 m
hohe "Teufelstisch" bei Hinterweidenthal aus dem Buntsandstein
des Pfälzer Walds. Der Felsen ist auf dem Titel des Buchs von
Martin SCHWARZBACH "Europäische Stätten geologischer
Forschung" von 1976 abgedruckt,  Die bis zu 1.230 m hohen Felsbuckel des
Monserrat etwa 45 nordwestlich von Barcelona in Katalonien
(Spanien) bestehen auch aus oiligozänen Sandsteinen und
Konglomeraten mit kalkigem Bindemittel. Aufgenommen am
17.05.1989 nach einem Brand, der das Buschwerk an den
Bergflanken schwärzte.
Die bis zu 1.230 m hohen Felsbuckel des
Monserrat etwa 45 nordwestlich von Barcelona in Katalonien
(Spanien) bestehen auch aus oiligozänen Sandsteinen und
Konglomeraten mit kalkigem Bindemittel. Aufgenommen am
17.05.1989 nach einem Brand, der das Buschwerk an den
Bergflanken schwärzte. 


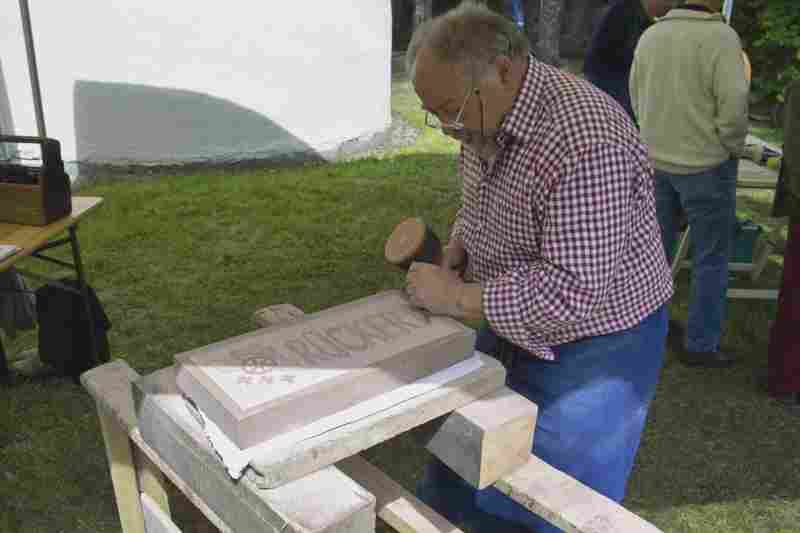
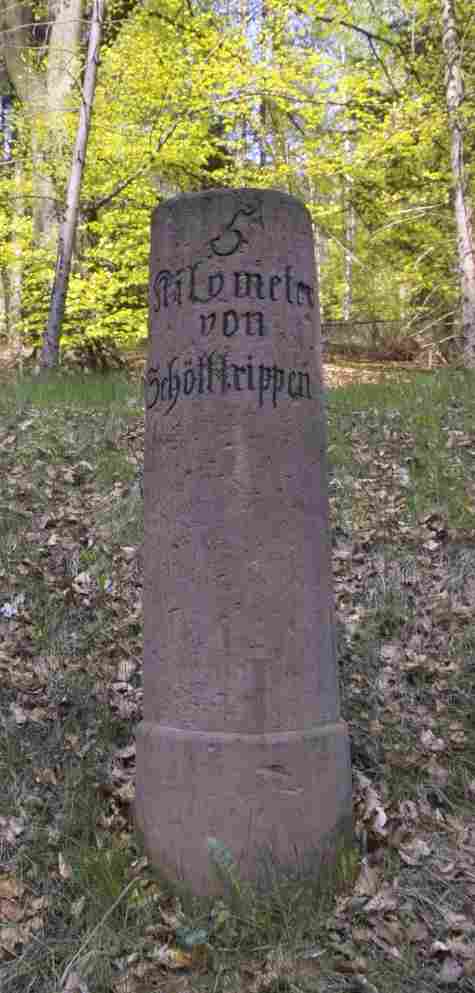






































 konkretionäre Kugeln im Sandstein
(Spessart-Museum, Lohr am Main)
konkretionäre Kugeln im Sandstein
(Spessart-Museum, Lohr am Main)  Chirotherium-Fährte (Spessart-Museum,
Lohr am Main)
Chirotherium-Fährte (Spessart-Museum,
Lohr am Main) 



























