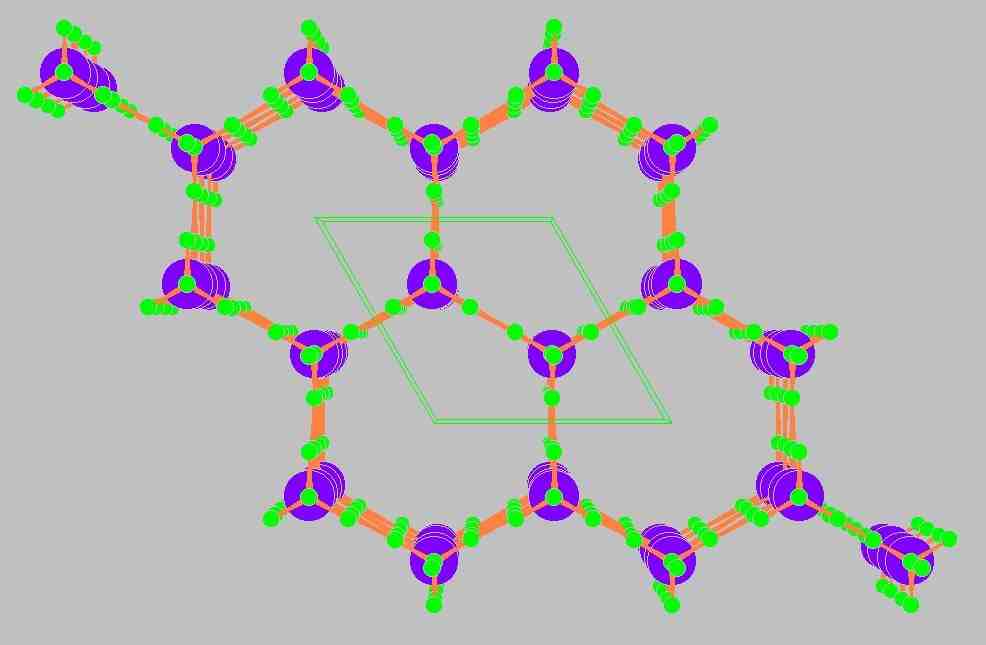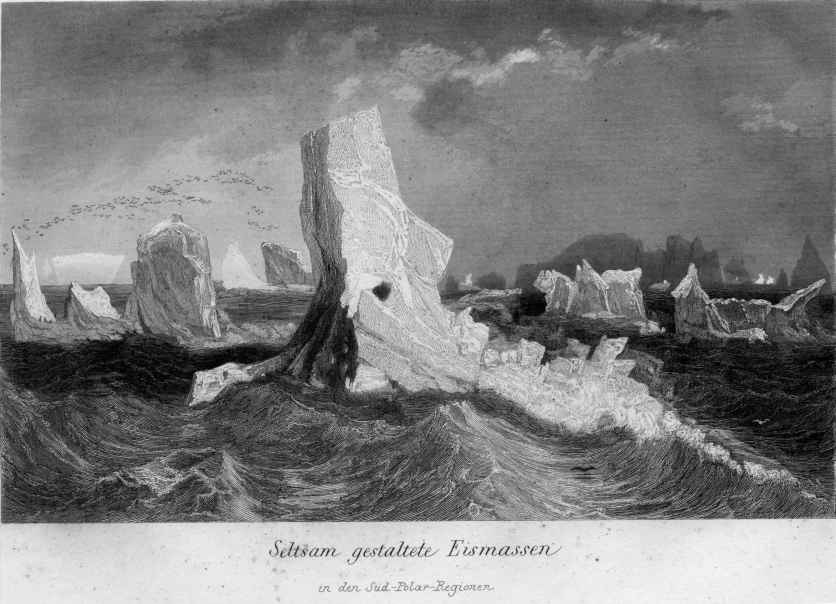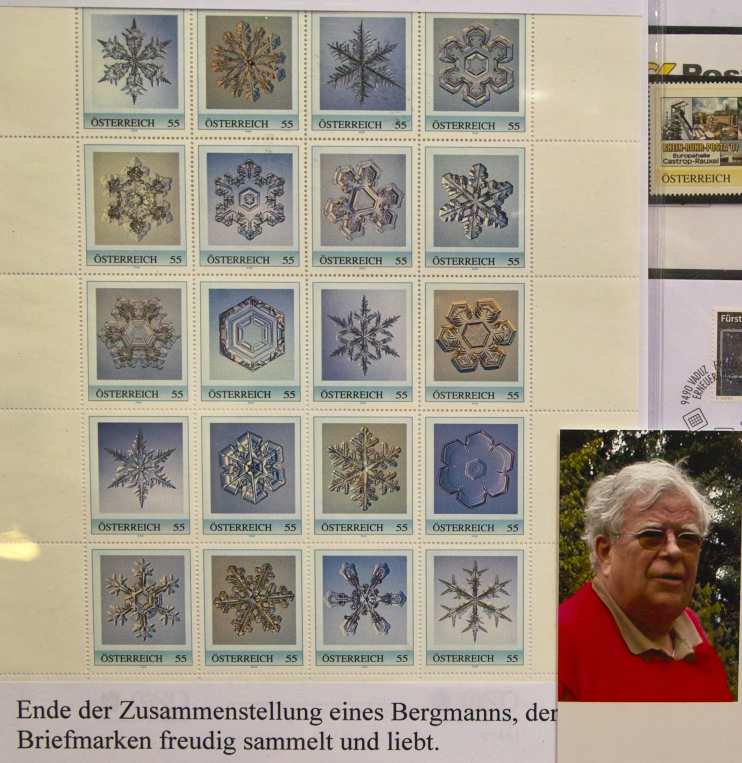Gab es in der Eiszeit Gletscher im
Spessart?
Die Seite vom
Mineral,
Gestein und
Lebensmittel
Eis.
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main



Links: Beeindruckende, oft meterlange, schöne Eiszapfen bilden
sich im Winter,
wenn das Wasser aus den Felswänden der Steinbrüche des Spessarts
austritt
und wegen des Frostes gefriert.
Mitte: Fiederförmige Eis-Kristalle auf Diorit, gebildet beim
Austritt feuchter Luft
und tiefem Frost, aufgenommen am 30.1.2011 bei Waldaschaff.
Rechts: Eis als dünne Schicht auf dem Wasser einer Pfütze im
Steinbruch,
aufgenommen bei Bessenbach am 26.02.2011.

Traumhaft. Kälte, Eis, Schnee & Sonne mit den Spuren der
Nacht.
aufgenommen bei Rottenberg am 06.01.2017

Der aufmerksame Waldgänger findet nach Regenperioden und
anschließendem
Frost an totem Holz gar nicht selten Haareis. Die Entstehung
wird durch den Pilz
Rosagetönte Gallertkruste (Exidiopsis effusa (BREF. ex.
SACC.) MÖLLER 1895)
verursacht (HOFMANN et al. 2015).
aufgenommen am 18.12.2019

Auch im Spätsommer kann man bei uns Eis als Halo sehen, wenn
auch über den Umweg der Lichtbrechung. Hier sind gleichsinnig
eingeregelte, kleine Eiskristalle in der Form von Prismen in
etwa 8 - 10 km Höhe die Ursache für die 22°-Halo, als am
06.09.2020 gegen 13 Uhr von Südosten ein Tiefdruckgebiet aufzog,
aber nur im Süden Bayerns Regen brachte. Wäre das von Westen
gekommen, so ist das "der" Anzeiger für schlechtes Wetter.
Aufgenommen in Dettingen a. Main (Karlstein) auf dem Parkplatz
des EDEKA-Marktes. Die Erscheinung war für etwa 1 Stunde zu
sehen. Der längliche schwarze Fleck bei 2 Uhr ist ein Vogel.
Halos gibt es auch um den Mond, so beispielsweise am 23.08.2024
gegen 5 Uhr (ohne Foto).
In der Natur kommt Wassereis weit verbreitet und in sehr großen
Mengen vor:
- Schnee (für Skifahrer),
- Graupel,
- Hagel (davor fürchten sich die Versicherungen),
- Reif,
- Gletschereis,
- Glatteis (mögen die Autofahrer garnicht),
- Firn, Bodeneis,
- Eisberge (Problem der Schifffahrt),
- Treibeis,
- Eiszapfen,
- Eisregen,
- Dauerfrostboden,
- ....
auch wenn man davon in unseren Breiten nur im Winter Notitz nimmt.
Aber es kann im ganzen Jahr auftreten in fast allem Monaten (außer
August) kann die Lufttemperatur selbst am Boden unter den
Gefrierpunkt von 0 °C fallen. In größeren Höhen der Atmosphäre ist
es immer so kalt, dass es zur Bildung von Eis kommt. Der Beweis
dafür sind Begungserscheinungen des Sonnenlichtes an Eiskristallen,
so wie hier in einem Kreis von 22°.

Eine 22°-Halo mit der Sonne im Zentrum,
durch die Hand abgedeckt
Die Eiskristalle müssen alle in einer bevorzugten Richtung in der
Luft orientiert sein, so dass eine Halo entstehen kann. Wenn dies
nur gering ausgeprägt ist, dann sieht man die häufigeren
Nebensonnen als helle Flecken neben der Sonne. Anders als beim
Regenbogen muss man zur Beobachtung immer gegen die Sonne schauen:
Vorsicht, denn man kann sich blenden und am besten deckt man die
Sonne mit Handfläche ab. Halos sind nicht so selten wie man denkt
und treten meist in hohen, dünnen Wolken auf, wenn das Wetter
umschlägt. Solche Beugungserscheinungen sind als Höfe auch um den
Mond zu sehen.

Schneekristall, ca. 2 mm groß
aufgenommen am 01.01.1986 in Dettingen
Der Name Eis kommt vom Mittelhochdeutschen "is" (wie im heutigen
Island - Name!) und ist in unserer Sprache stark vertreten:
Blitzeis • Blockeis • Bodeneis • Eis • Eis-1h • Eisabgang •
Eisablation • Eisabwehr • Eis-Albedo-Rückkopplung • Eisansatz •
Eisaufbruch • Eisbahn • Eisbank • Eisbär • Eisbarriere • Eisbasier • Eisbaum • Eisbecher •
Eisbedeckung • Eisbeil • Eisbein • Eisbekämpfung • Eisberg •
Eisbergflotte • Eisbeutel • Eisbewegung • Eisbildung • Eisblänke
• Eisblase • eisblau • Eisblick • Eisblink • Eisblock • Eisblume •
Eisblumenglas • Eisboden • Eisbohrung • Eisbombe • Eisbonbon • Eisbosseln • Eisbrecher • Eisbrecherfrage •
Eisbrecherflotte • Eisbrei • Eisbrevier • Eisbruch •
Eisbrücke • Eisbucht • Eisbude
• Eiscafe • EISCAT • Eiscreme • Eisdecke • Eisdessert •
Eisdicke • Eisdiele • Eisdienst • Eisdom • Eisdruck •
Eisdruck-Strandwälle • eisen • Eiseiche • Eiseimer • Eisente • Eiserzeugung • Eiseskälte •
Eisessig • Eisfahrt • Eisfalte • Eisfalter • Eisfarbe • Eisfeld
• Eisfische • Eisfischerei • Eisfjord • Eisfläche • Eisflanke •
eisfrei • Eisfront • Eisfuchs • Eisfuß • Eisfunk • Eisgang • Eisgänger •
eisgekühlt • Eisgetränk •
Eisgewächs • Eisglas • Eisglätte • Eisgrat • eisgrau • Eisgrenze • Eisgruppe
• Eisgürtel • Eishai • Eishaken • Eishammer • Eishang • Eishaut •
Eisheilige • Eishochwasser • Eishöhle • Eishorizont • eisig •
Eisinsel • Eisjacht • Eisjagdkultur • Eiskaffee • Eiskalotte •
eiskalt • Eiskamin
• Eiskappe • Eiskegel
• Eiskeil • Eiskeilgenereation • Eiskeilhorizont • Eiskeilnetz •
Eiskeilpolygon • Eiskeilpseudomorphosen • Eiskeim • Eiskeller • Eiskern •
Eiskernbohrung • Eiskessel
• Eisklappe • Eiskliff • Eiskluft • eisklüftig • Eisklumpen • Eiskockey •
Eiskonfekt • Eiskorn • Eiskörper • Eiskraut •
Eiskrautgewächse • Eiskrem
• Eiskristall • Eiskübel • Eiskühler • Eiskümmel • Eiskunstlauf •
Eiskünstläufer • Eiskunstläuferin
• Eiskuppel • Eisküste • Eislagenzählung • Eislast • Eislauf • Eisläufer • Eisläuferin • eislaufen •
Eislawine • Eisler
• Eislinsenbildung • Eisloben • Eismächtigkeit • Eismann •
Eismaschine • Eismasse • Eismeer • Eismeerstraße •
Eismeerdampfer • „Eismitte“ • Eismonat • Eismond • Eismöwe
• Eisnadeln • Eisnagel
• Eisnebel • Eisnutzung
• Eispalast • Eispapier • Eispartikel • Eispflanze • Eispflug • Eispickel • Eispilz •
Eispressung • Eispulver • Eispunkt • Eisrandablagerung •
Eisregen • Eisrevue • Eisriese
• Eisriesenwelt • Eisrindeneffekt • Eisrinne • Eisruck •
Eissalat • Eissäule • Eisscheide • Eisschelf • Eisschicht •
Eisschieben • Eisschießen
• Eisschild • Eisschlamm • Eisschlitten • Eisschmelze • Eisschneide • Eisschnellauf
• Eisscholkolade • Eisscholle • Eisschrank • Eisschraube •
Eisschubberge • Eisschürze
• Eisschütze • Eissegeln • Eissegelboot • Eisspat • Eisspeedway • Eisspeisen • Eisspiel • Eissporn • Eissport •
Eissprosse • Eisstadion • Eisstalagmit • Eisstalagtit • Eisstand
• Eisstausee • Eisstauung
• Eisstein • Eisstock
• Eisstockschießen • Eisstoß
• Eisstromnetz • Eisstufe
• Eissturmvogel • Eissurver • Eistag • Eistanz • eistanzen • Eistaucher • Eistechnik • Eistüte • Eistorte
• Eisumschlag • Eisvenen • Eisverbreitung • Eisverdunstung • Eisvergiftung • Eisverkäufer • Eisverschluß
• Eisversetzung • Eisverstärkung • Eisvogel • Eisvorhersage •
Eiswarndienst • Eiswasser • Eiswein • Eiswolke • Eiswolle •
Eiswürfel • Eiswüste • Eiszange
• Eiszapfen • Eiszeit • Eiszeitalter • Eiszeitkunst •
eiszeitlich • Eiszelle
• Eiszerfallslandschaft • Eiszunge • Filchner-Schelfeis •
Flankenvereisung • Flankenvereisung • Flockeneis •
Flugzeugvereisung • fossiler Eiskeil • Glatteis • Gletschereis • Haareis • Höhleneis •
Inlandeis • Inlandeis • Kammeis • Klufteis • Kunsteisbahn •
Landeis • loseisen • Meereis • Milchspeiseeis • Neueis • Packeis
• Piccolo-Eiskühler • Polareis • Presseisrücken • Randeis
• Ross-Schelfeis • Schelfeisküste • Schelfeisrand • Scherbeneis
• Seeeis • Speiseeis • Speiseeisbereiter • Tafeleisberg •
Toteislöcher • Treibeis • Vereisung • Wassereis •
Welteislehre • Zwischeneiszeiten • ......
(Die Aufzählung ist vermutlich nicht vollständig)
Mengenmäßig sind ca. 92 % des Welteisvorrates in der
Antarktis und 7 % in Grönland fixiert (zusammen ca. 32 Millionen
km³). Der Rest von ca. 1 % sind dann alle Alpengletscher,
alle Eismassen in Spitzbergen, Alaska, Himalaya und aller Schnee
im Winter, .... Deshalb wird in der Antarktis und in
Grönland bestimmt, welche Eismenge auf der Erde vorhanden ist.
Und dabei spielt die weitgehend unzugängliche Ostantarktis mit
ihren ungefähr 10 Millionen km² die Hauptrolle. Hier liegt das
Eis bis zu unvorstellbaren 4.776 m dick! Darunter könnte man die
ganzen Alpen verschwinden lassen. Und es hat eine
Jahresdurchschnitts-Temperatur von etwa -50 °C. Hier - und nicht
im sprichwörtlichen Sibirien - ist es mit weitem Abstand am
kältesten auf dem Globus.
- In der abgelegenen und Millionen km² großen Hochfläche
der Ostantarktis, gebildet aus dem bis zu zwei bis vier km
dicken Eis werden im Jahresmittel Temperaturen von nur -55 °C
erreicht. Dies bedeutet, dass es auch im Sommer nie flüssiges
Wasser gibt. Im sonnenscheinlosen Winter (während bei uns
Sommer ist) werden jedes Jahr Temperaturen von unter -80 °C
erreicht, so dass hier selbst das CO2 der Luft
resublimieren kann: es gibt dann Schnee aus festem Kohlenoxid!
Der Rekord für die tiefste dort gemessene Temperatur liegt
gegenwärtig bei -89 °C (russische Forschungsstation Wostok).
Hier ist überhaupt kein Leben möglich und es ist die einzige
große abiotische Zone auf der Erdoberfläche, also wie auf dem
Mars. Im Vostok-See unter dem kilometer dicken Eis könnte es
dagegen ("fossiles") Leben geben.
Übrigens führt eine globale Erwärmung von ein paar Grad
Celsius hier zu keiner wesentlichen Veränderung. Und derzeit
wächst das Eisvolumen der Antarktis an.

Der große Aletschgletscher in der Schweiz, mit 15 km³ Eis und 22
km Länge der größte in den Alpen.
aufgenommen im August 1993
In der Natur auf der Erde gibt es nur eine Sorte Wassereis, das
Eis der Strukturvariante Eis-1h. Es kristallisiert
hexagonal (Schneestern!) und wird mit zunehmender Kälte immer
härter. Im Labor kann man unter Druck und anderen Temperaturen
weitere Eisvarianten erzeugen und auf den Planeten des
Sonnensystems kommen auch andere Eisvarianten (~phasen) und in
einer amorphen Phase vor.
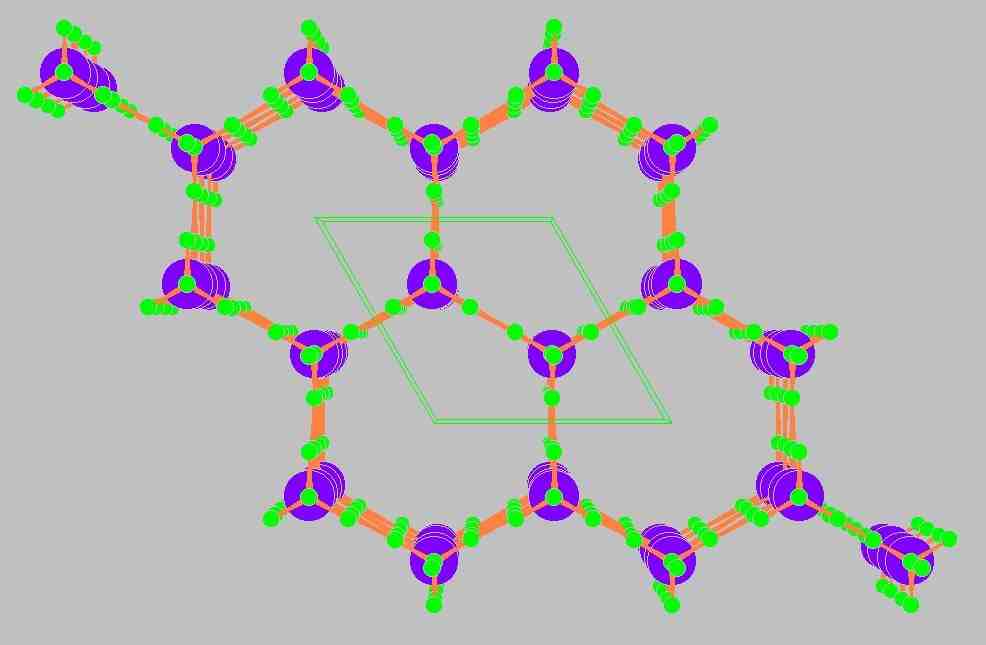
Die Struktur der Eis-1h
(große Kugeln Sauerstoff,
kleine Kugeln Wasserstoff)
Eis ist per Definition ein Mineral (kristalline und natürlich; kann
auch als monmineralisches Gestein wie bei den Gletschern auftreten),
aber nicht zu sammeln, es sei denn mit dem Fotoappart. Dabei kann es
durchaus Sinne machen, statt der üblichen Mineralien sich für die
Schönheit der Kälte zu begeistern.


Der verschneite Steinbruch in Hemsbach an einem bitterkalten Tag
(08.02.2003) im Winter
und daneben Luftblasen, gefangen in der ca. 15 cm dicken
Eisschicht einer Kiesgrube am 04.11.1993.
Frischer Schnee (Bildhintergrund) besteht aus den
Schneekristallen, die oft schon in der Luft zu Schneeflocken
zusammenkleben. Nachdem sie auf den Boden liegen, beginnt eine
Metamorphose. Da der Boden wärmer ist, die Luft schnell abkühlt,
gibt es ein Temperaturgefälle in der Schneedecke. So verdampft ein
Teil der ganz kleinen Schneesterne und der Wasserdampf steigt nach
oben und trifft auf die Kristalle an der Oberfläche, wo es
insbesondere Nachts sehr kalt werden kann. Hier wachsen die
Schneekristalle, wenn es tagsüber kalt bleibt, bis zu cm-großen,
federartigen Kristallen heran. Infolge eines immer vorhandenen
Verlustes an die Atmosphäre nimmt dabei die Schneedicke ab, ohne
dass der Schnee schmelzen muss, er sublimiert einfach.
Wird die Schneeschicht dicker und wird kompaktiert, bildet sich
Firn und daraus nach Jahren dann das massive Gletschereis. Ist es
dick genug, beginnt es unter dem eigenen Gewicht plastisch zu
werden und "fließt".
Es gab immer schon kältere und wärmere Phasen der Erdgeschichte.
So war das südliche Afrika in der permokarbonischen Eiszeit
vergletschert und aus dem Eis ausgeschmolzene Steine ("dropstones"
) fand man in Sedimentgesteinen Thüringens. Vor ca. 2 Millionen
Jahren wurde es nach einer langen warmen Periode kälter und es kam
zur Bildung von Gletschern in Skandinavien, die bis nach
Deutschland reichten. Kältere und wärmere Perioden wechselten sich
ab und hinterließen Sedimente, die nach Flüssen benannt wurden.
Die letzte Kaltphase (Würm bzw. Weichsel) endete vor ca. 20.000
Jahren und hinterließ bei uns neben den Hangschutten,
Felsfreistellungen, Kies und Sand auch
den Löss .
Im Spessart gab es während der
letzten Kaltzeiten keine Gletscher*, sondern nur eine offene
und baumlose Tundrenlandschaft ("Kältesteppe") wie im
heutigen Nordskandinavien.
Bevölkert von sehr wenigen - oder in den kältesten Phasen
keine - Menschen, gab es Mammute, Wollnashörner, Rentiere,
Moschusochsen, .... Der Boden war metertief gefroren und taute
im Sommer nur gering auf. Dabei wurde der Boden an den Hängen
mobil und er kroch talwärts; diese Böden nennt man solifluktiv
umgelagert. Über den Wind wurde Staub herangetragen und
deponiert, den wir heute Löss nennen.
In den Ton- und Lehmgruben des Spessarts konnten solche glazialen
Formen und Spuren überall beobachtet werden. Im Winter froren die
Flüsse bis auf den Grund zu und die tauenden Eismassen konnten
große Steine transportieren. Sie werden bei Hausbauten und in
Kiegruben als "Findlinge" ausgesondert und meist zur
Gartengestaltung verwandt. Der größte Teil ist inzwischen durch
menschliche Aktivitäten verschwunden.
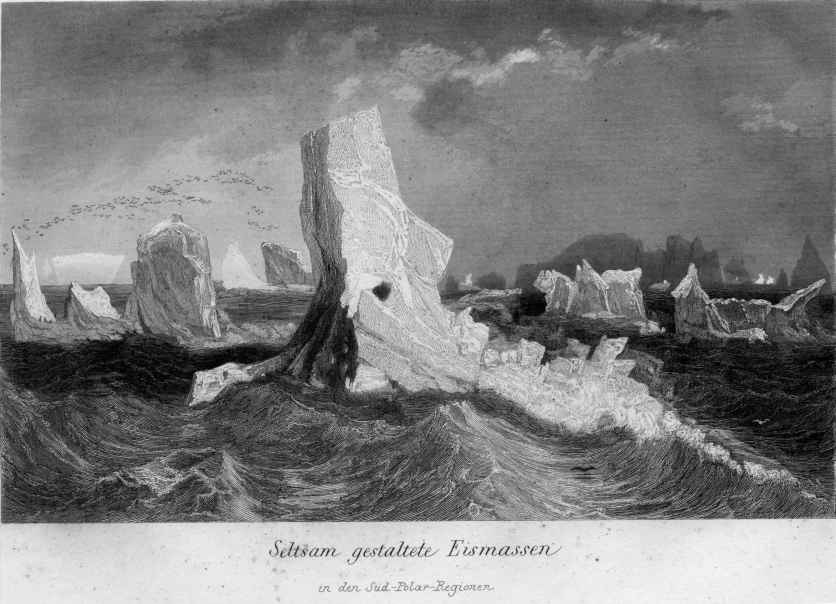
Eisberge im Südpolarmeer. Stahlstich aus LEONHARD (1846:203),
entstanden in
einer Zeit als es gerade 20 Jahre her war, dass jemand das
Festland der Antarktis
betreten hatte. Die Erforschung begann erst im 20. Jahrhundert.
Und das Wissen
um das Wetter dort ist dann erst seit etwa 50 Jahren gewachsen.

Große Eisberge im See Jökulsarlon am riesiegen Gletscher
Vatnajökull an der
Südküste von Island - sie erinnern an ein berühmtes Gemälde von
Kaspar David FRIEDRICH. Die Schwärze ist eingeschlossene
Vulkanasche,
aufgenommen am 09.08.2002.
Sie sind jetzt aufmerksam und neugierig geworden? Dann hören Sie
die noch mehr Fakten zum Eis auf einem Vortrag
mit schönen Bildern.

Wenn man an den frühen Ostertagen 23.03.2008 in die Steinbrüche
des Spessarts wollte (wie hier in Sailauf), wurde man von einer
dicken Neu-Schneeschicht überrascht, die in den folgenden Tagen
noch bis auf ca. 30 cm anwuchs. Trotz der gegenwärtigen
Klimadiskussion hält sich das Wetter nicht an kalendarische Regeln
und damit einfach chaotisch in weiten Grenzen, so dass es mit der
lokalen Vorhersage auch schwierig bleibt. Einmal mehr war der März
damit der schneereichste Monat in der Region - und nicht der
Dezember mit Weihnachten.
Gedanken zum Wetter (was viele Medien mit Klima
verwechseln).
Das Wetter ist grundsätzlich chaotisch und damit so schwer
vorhersagbar - auch weil es in der Zukunft liegt. Da es keinen
Kalender kennt, treten die gewünschten Wetterlagen kaum zur
richtigen Zeit auf. Also im November und Anfang Dezember kalt,
dann zu Weihnachten wärmer und kein Schnee und zum Jahreswechsel
wieder kalt - oder eben auch nicht. Das war früher auch so, wird
nur einfach vergessen, das menschliche Gedächtnis kein Recorder
ist, der ungefiltert aufzeichnet.
Die Kaltfront vom Jahreswechsel 1978
/ 1979
Im Frühjahr 1978 hatte ich mein erstes Auto gekauft: ein
gelber VW-Bus (T2) mit dem luftgekühlten 50-PS-Motor. Und
wenn ich konnte, baute ich das Auto zu einem
Campingfahrzeug um. Alles in Eigenleistung und das ist
infolge der beengten Verhältnissen im Auto eine
zeitintensive Bastelarbeit. Dabei hörte ich Radio. So auch
zum Jahresende, als man las und hörte, dass eine Kaltfront
von Norden auf uns zu rückt. Man hörte im Radio, dass der
Wind in den flachen Gebieten Norddeutschlands den Schnee
zu meterhohen Verwehungen zusammen treibt und dass die
Bundeswehr im Norden Deutschlands Hilfe leistet. Dass
ganze Züge "verloren" gingen und keiner wusste, wo die
geblieben sind. Es gab ja keine Mobiltelefone. In
Nordamerika würde man von einem "Blizzard" (schweren
Schneesturm) reden.
Der Main führte etwas Hochwasser. Und bei
uns regente es immerzu. Dabei muss man
wissen, dass bei uns der 30.12. der Tag mit höchsten
Regenwahrscheinlich war/ist. Es regente auch am 31.12.1978
weiter. Im Radio hörte ich, dass man in Bad Homburg das
Eis von der Oberleitungen der Straßenbahn klopfen musste.
Hier regente es weiter und es waren 11 °C, als ich gegen
13 Uhr im strömenden Regen zu einer Silvesterfete nach
Aschaffenburg fuhr. Mit dem geliehenen Auto meines Vaters.
Es wurde wie angekündigt kälter und so ging der Regen am
Nachmittag in Schnee über. Und es schneite so stark, dass
der Schnee auf dem noch warmen Boden gegen 16 Uhr liegen
blieb:

Und es wurde kälter und schneite immer weiter. Wir hatten
Spaß mit den Mädels, auch mit einem kleinen Feuerwerk zum
Jahreswechsel, aber es war einfach zu kalt für draußen -
richtiger Frost (es kitzelte in der Nase) und ein
schneidend eiskalter Wind blies einem die Schneekristalle
auf die Haut. Aber gegen 1.30 Uhr glaubte ich nach Hause
fahren zu müssen, denn man wusste nicht, ob der Schnee
noch mehr wird. Also suchte ich das Auto an der Straße.
Für manche Autos hätte man eine Schaufel benötigt, um die
frei zu bekommen. Ich hatte Glück, denn der rote Opel
Kadett C Caravan mit dem Kennzeichen AB KS 938 und mit
einem Ventilator als Sonderausrüstung(!) war nur etwas mit
dem Pulverschnee eingeweht.

Es war schneidend eiskalt und ich musste das Auto erst vom
Schnee befreien, um fahren zu können. Es sprang an, aber
es wurde gar nicht warm im Auto (1,2 Liter
Hubraum und 55 PS; damals fuhr man noch mit verbleitem
Benzin). In Kleinostheim waren die
Schneeverwehungen auf der B8 so hoch, dass man in
Schlangenlinien fahren musste. Es war kein Mensch zu Fuß
auf der Straße, ich sah auch kein anderes Auto auf der
Fahrt von Aschaffenburg nach Dettingen; alles sah sehr
fremd und verweht aus. Zu Hause angekommen, musste ich
zunächst den Schnee vor der Einfahrt wegschippen. Und dann
klärte der Blick auf´s Thermometer die Beobachtungen: -18
°C. Nach dem morgendliche Aufstehen war die Temperatur auf
-21 °C gefallen, alles war von Schnee bedeckt und es gab
Schneeverwehungen. Also in 24 Stunden ein Temperatursturz
von knapp über 30 Grad! So was hatte ich vorher nur aus
Reiseberichten in Kanada und den USA gelesen.

So sah die Graslitzer Straße in Dettigen nach dem
Hellwerden am Morgen des 01.01.1979 aus. Es gab noch Ford
Transit, VW Käfer und Fernsehantennen, keine Schüsseln für
Satelliten, auf den Dächern. Alles war steif gefroren und
wegen des Feiertages waren auch keine Menschen unterwegs.
Aber es gab grundsätzlich keine Probleme, die über das
normale Maß eines Winters hinaus gingen; viele hatten ja
noch den sehr strengen Winter von 1962/1963 in Erinnerung
und Erfahrung damit. Ich machte mit Wanderschuhen,
Gamaschen und dick angezogen einen Rundgang um Dettingen.
Dann stellte ich einen elektrischen Heizlüfter in den
VW-Bus und baute am Bus weiter.
Die kalte Luftmasse rauschte bis in die Alpen. Und bei uns
blieb es auch am Tag unter dem Gefrierpunkt, so dass
überall Eiszapfen wuchsen. Und auf dem Main musste die
Schifffahrt eingestellt werden, weil der Main zufror. Wo
nicht, da trieben die Eisschollen vor den Schleusen zu
Bergen von Eis zu sammen, so dass auch hier kein
Durchkommen mehr war. Nachts rutsche das Thermometer auf
die -20 °C zu und so blieben Schnee und Eis etwa 3 Wochen
lang. So gab es auch eine schöne Seite der Kälte mit
vorher nicht gesehenen Phänomenen an Schnee und Eis.
Besonders betroffen waren die Ebenen im Norden
Deutschlands, der Niederlande, der DDR und Dänemarks, da
der Schnee an allen Hindernissen wie Hecken, Bäumen,
Häusern, Straßenbegrenzungen, usw. zu hohen Bergen
aufgetürmt wurde. Das stellte die Versorgung schon auf
Schwierigkeiten.
7. Februar 2021: eine wesentlich weniger ausgeprägte
Kaltfront wiedeholt das. Erneut chaotische Zustände auf
den Autobahnen in der Mitte Deutschlands.
Es ist alles vergessen.
|
Schnee und Eis in den vergangenen Jahren:
2024
Am frühen Morgen des 26.03.2024
sah ich "Nebensonnen" am tief stehenden Vollmond. Leider war
die Erscheinung nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Mit dem
Smartphone konnte ich kein verwertbares Foto machen - bis ich
meine Kamera geholt hatte, war die Erscheinung wieder
verschwunden.

Das Museum in Karlstein an der Schulstraße 2: Schneetreiben bei -1
°C führt zu 5 cm Neuschnee und in der Folge zu strengem Frost. Das
Streuen von Tausalz führte dazu, dass Straßen und Gehwege nach
wenigen Stunden wieder vom Eis und Schnee befreit waren.
Aufgenommen am 18.01.2024
2022


So ein normaler Winter mit Anfang Dezember kalt und dann die
weihnachtliche Tauphase kann trotzdem mit schönen
Phänomenen aufwarten. Ich der Nacht regnete es, dann Aufklaren und
die Temperatur fällt knapp unter 0 °C, so dass
besonders auf den schnell auskühlenden Autos das Wasser gefriert.
Dabei bilden sich vom kältesten Punkt und ausgehend
von Schmutzpartikeln aus sehr flache Kristalle, die aufgrund von
Wachstumsstörungen (Schraubenversetzung, Stapelfehler
und eine Art Whisker) in runden Bögen wachsen, bis die sich
gegenseitig berühren. Nun könnte man denken, dass das die
Reste der Wischbewegung bei der Autowäsche sein können, aber auch
Fahrzeuge, die nie gewaschen werden, zeigen solche
Muster. Darüber hinaus wird durch die sinkende Temperatur aus der
Luft die Feuchtigkeit ausgetrieben, so dass auf dem Eis
dann ein nadelig-pelziger Reif wächst (Resublimation). Die
Kristallisiationswärme die bei der Bildung des Eises frei wird,
kann auf den Blechflächen gut abgeführtwerden, so dass das Wachstum
schnell erfolgt. Nach 1/2 h Sonne war die Pracht
wieder Wasser;
gesehen am 28.12.2022 in Karlstein-Dettingen.

Nun neigt man zu der Vermutung, dass das Wetter einen Kalender
kennt. Dem
ist nicht so, denn am Morgen des 2. April 2022 wurden selbst die
Menschen in
den Tieflagen des Untermains von einer bis zu 5 cm dicken
Schneeschicht
überrascht. Hier der Blick auf den blühenden Zwetschgenbaum am
frühen
Morgen in Dettingen. Dass die Straßen frei blieben, war nur dem
Umstand
geschuldet, dass der Boden noch nicht ausgekühlt war.
2021

Schnee im April! Auf einer Bank an der Straßenkreuzung der B26 mit
der Straße von Heigenbrücken
nach Weibersbrunn im Spessart liegen bei 0 °C etwa 7 cm
Neuschnee;
aufgenommen am 08.04.2021

Der lang anhaltende Regen im Janaur 2021 sättigte das Kluftnetz
und als der Frost
Anfang Februar kam, wurde das austretende Wasser zu Eis. Infolge
der nächtlichen
Kälte von unter -10 °C froren alle Tropfstellen zu diecken
Eiszapfen, die
auch am Tag nicht abtauten, da die Lufttemperatur nicht über den
Gefrierpunkt stieg.
Aufgenommen am 12.02.2021 an der Grube Wilhelmine in Sommerkahl
2020

Da wacht man am Morgen ganz früh auf - und es schneit. An den Rippen
im
Schnee sieht man, dass das Verbundpflaster im Boden noch warm ist,
so dass
der Schnee wieder schnell weg taut.
Aufgenommen am 05.12.2020
2017

Wie so oft: Anfang Dezember Schnee. Die Kreuzung der Bahnstrecke mit
der
Bundesstraße 26 südlich von Laufach-Hain am Viadukt,
aufgenommen am 03.12.2017
2016

Kleine Eislinsen mit strahligem Aufbau als Sublimationsprodukt auf
dem Boden;
die einzelnen Disken haben einen Durchmesser von ca. 15 mm,
gesehen auf der Tunnelbaustelle bei Hain am 04.12.2016

Auch wenn im Sommer 2015 ein strenger Winter angekündigt wurde -
er kam nicht und schon gar nicht zu Weihnachten. Aber Mitte Januar
2016 fiel der Niederschlag als Schnee und blieb infolge der klaten
Luft liegen. Das Bild zeigt einen naturnahen Rotbuchenwald mit
Alt- und Fallholz bei Hain,
aufgenommen am 17.01.2016.

Kreisförmiger 22°-Ring, Halo genannt (umgangsprachlich aus als
"Hof"
bezeichnet) um den Mond,
aufgenommen in der ägyptischen Ostwüste am 18.02.2016.
Wenn Eiskristalle in großer Höhe (8 - 10 km) von der
Luftströmung eingeregelt werden, können sie (farbige)
Lichtbrechungserscheinungen hervorrufen. Im Gegensatz zum
Regenbogen muss man gegen die Lichtquelle (Sonne, Mond) schauen
und dann sind es meist helle Kreise, die man sehen kann. Diese
Lichterscheinungen werden als Halo bezeichnet. Je nach der Form
der Eiskristalle und deren Orientierung zwischen Beobachter und
Lichtquelle können auch mehrere Ringe, Knoten (Nebensonnen) und
Kombinationen daraus sichtbar sein. Wenn es zu wenige Eiskristalle
sind, dann ist die Lichterscheinung schwach, wenn es zu viele
sind, absorbieren die Massen das Licht, so dass es nur unter den
seltenen, optimalen Bedingenen klappt. Diese Erscheinungen sind in
der Regel meist nur Minuten bis Stunden zu sehen. Sie sind nicht
selten, werden aber meist nicht als solche erkannt.
2015

Fast eine Kunstwerk. Dünnflüssiger Schlamm, bei -3 °C gefroren zu
einem federartigen Muster in Braun,
aufgenommen am 24.01.2015 auf der Tunnelbaustelle südlich von
Hain.
2014

Und trotz der dauerhaften Diskussion um das sich erwärmende Klima
gab´s auch 2014 wieder grüne Weihnachten; die Winter der letzten
Jahre sind vergessen. Aber am 27.12.2014 zog ein großer
Wolkenwirbel über den Westen Deutschlands und hinterließ eine
geschlossene Schneedecke - siehe oben am 28.12.2014. Da der
nachweihnachtliche Reiseverkehr begonnen hatte, stauten sich die
Fahrzeuge auf der Autobahn A3 über den Spessart in beide
Richtungen auf 45 km!
2013


Der Winter 2013/14 begann im Spessart mit leichtem Schneefall und
Reif - der Nebel wich am 26.11.2013 auch tagsüber nicht und so
wuchsen bei
leichtem Frost die Eiskristalle weiter; so wie hier im
Schwarzbachtal östlich von Hain i. Spessart.
2013
Eisregen entsteht, wenn eine Warmfront auf bodennahe Kaltluft
aufgleitet und der Regen in der kalten Luft gefriert. Sind
Kristallisationkeime vorhanden, so bilden die runde Kügelchen oder
Graupel. Fehlen diese, dann fällt das unterkühlte Wasser bis zum
Boden, um dort schlagartig zu gefrieren.
Beide Niederschlagsphänomene haben massive Auswirkungen auf den
Verkehr. Bei entsprechend dicker Eisauflage auf den Straßen kann
man weder mit dem Auto fahren noch sich als Fußgänger sicher
bewegen (es sei denn, man verwendet Spikes).
Auch Flugzeuge können nicht mehr enteist werden und die Bahnen
haben Probleme, wenn die Oberleitungen vereist sind.


Nach einer Kälteperiode kam es am Nachmittag, des 20.02.2013 zu
einem Eisregen, bei dem der Regen zu kleinen Kügelchen gefror.
Links über dem
durch das Moos durchgepausten Stein eines Verbundpflasters, rechts
im Ausschnitt ist der eingelegte Maßstab 1 cm³ groß. Die
Besonderheit sind die
2 - 3 mm großen und völlig klaren Eiskügelchen, wie
Glasperlen.

Die Region Rhein-Main präsentierte sich winterlicher als der
Hochspessart,
am Lohwald mit den Eichen bei Offenbach.
aufgenommen am 24.01.2013
Der Grund liegt darin, dass am 20.1.2013 zunächst der Eisregen
die Bäume und Sträucher nässte bzw. mit einer dünnen Schichts Eis
überkrustete. Dann fielen die Eisperlen (siehe oben), darauf
neuerlich etwas Regen und anschließend nochmals ca. 8 cm
Neuschnee. Der war erst nass und dann in der Nacht zum Montag
pulvrig. Die "klebrige" Unterlage sorgte dafür, dass der Schnee
auf allen Zweigen udn Nadeln hängen bzw. liegen blieb. Die Auflage
war dauerhaft, während im Hochspessart die Schnee wieder von den
Zweigen geweht wurde, weil hier kein Eiseregen fiel. Da der
Verbund dauerhaft vom Frost und der Sonne durch Wolken bewahrt
wurde, präsentierte sich die tief liegende Region in einem
dauerhaften Weiß, welches über eine Woche lang zu sehen war.

Überfrorene Graupel, Man erkennt noch Schneesterne, an die sich
winzige
Wasertröpfchen angelagert haben, so dass das weiße mehr oder
minder
rundliche Eisgebilde wurden, Bildbreite 3 cm.
aufgenommen am 07.02.2013.

Das Bauen von Schneemännern hat eine lange Tradition. Hier wurde
eine ganze Schnee-Familie erbaut; man beachte die
Schneefrau im Bikini!
Aufgenommen am 24.02.2013 in einem Garten in Rottenberg.

Das Rhein-Main-Gebiet wurde am Dienstag, den 12.03.2013 von einem
großen Niederschlagsgebiet ganz langsam überquert, welches an
einem Tag mit heftigem Schneefall und nicht gefrorenem Boden mehr
als 15 cm Neuschnee hinterließ. Dies führte in der Schnee nicht
gewohnten Region zu chaotischen Verkehrsverhältnissen, so dass man
unverständlicherweise in Offenbach und Frankfurt sogar den Bus-
und S-Bahnbetrieb einstellte. Es schneite so heftig, dass das
ausgstreute Tausalz nicht in der Lage war, den fallenden Schnee
bei -3 bis -4 °C abzuschmelzen, so dass sich auch die viel
befahrenen Ausfallstraßen in einem Weiß zeigten. In den
Mittelgebirgen der Umgebung war dagegen deutlich weniger Schnee
gefallen. Die folgenden Tage waren von starkem nächtlichen Frost
mit unter -10 °C geprägt, so dass man durchaus von einem
"Märzwinter" sprechen konnte.
2012
Und 2012? Zunächst prognostizierten die Medien mit Verweis auf
"Fachleute" noch im Janaur 2012 dass es keinen Kernwinter mehr
geben kann! Dann kam der Frost mit bis zu -15 °C, viel Sonne und
einem kalten Ostwind und hielt mind. 2 Wochen an. Der Main führte
Treibeis. Da kein Schnee lag, erwärmte die Sonne den Boden, so
dass die Temperaturen tagsüber auf ca. -5 °C ansteigen
konnten.


Und am 11.02.2012 war der Main in Aschaffenburg wieder zu
gefroren. Nur wenige Stellen blieben aufgrund der Strömung am Tag
eisfrei.
Nach zwei Wochen mit Temperaturen von nachts bis -18 °C und
tagsüber trotz Sonne nur ca. -5 °C friert auch der Main zu -
Eis soweit das Auge reicht.
Trotz der gegenteiligen Prognosen begann der Winter 2012/2013 mit
Schnee und teils strengem Frost, so dass sich in den Steinbrüchen
Eisezapfen ausbildeten.

Meterlange Eiszapfen, teils schräg und sich verzweigend in der
Wand des Rhyoliths von
Sailauf,
aufgenommen am 13.12.2012
2011

cm-langes Haareis an einem Holzstängel bei Frammersbach,
aufgenommen am 20.02.2011
Haareis kann man in der Regel an Hölzern beobachten. Dazu muss es
nach einer Regenperiode einen mäßigen Frost über mehrere Tage
geben. Dann wachsen aus dem Holz entlang von Rissen und Poren
haarfeine Eisnädelchen von bis zu einigen cm Länge. Die filigranen
Gebilde sind sehr empfindlich gegenüber Berührung, Wärme und
Sonnenlicht. Dabei wird das im Holz befindliche Wasser aus dem
Holz in Eis umgesetzt und infolge der Kapillarkräfte wird so lange
Wasser nachgeliefert, bis die Bildung bei zu strengem Frost zum
Erliegen kommt. Mit Pilz(myzelien) durchsetzte Hölzer zeigen die
Erscheinung besonders gut, da diese größere Mengen Wasser
speichern als Hölzer ohne Pilze.
Die Bildung von haarförmigen Kristallen sind aus dem Mineralreich
hinreichend bekannt, denn haarförmige Mineralien sind weit
verbreitet (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Halit, Gips,
Malachit, Amphibole, Kaliumnitrat, gediegen Silber, Antimonit, ...

Eisfall bei Waldaschaff,
aufgenommen am 26.02.2011.
Es ist ein Produkt am Nordhang der Felsen nach tagelangem Frost
und fehlender Sonne, so dass das zwischen Bröckelschiefer und
Diorit austretende Wasser gefrieren kann. Der "Eiswasserfall"
bildete sich während des strengen Frostes Anfang Februar 2012
neben der Autobahn erneut.
2010
Und 2010?
Nach einem schneereichen Winter 2009/2010 konnte man im Dezember
2010 spüren, dass die langfristigen Wettervorsagen nicht
funktionieren. Früh kam der Schnee und blieb zumindest in den
höheren Lagen dauerhaft liegen. Kurz vor Weihnachten das übliche
Tauwetter und pünktlich zum 24.12.2010 ging der Regen am späten
Nachmittag in Schnee über und am 25.12.2010 hatten wir 15 cm
pulvrigen Neuschnee im Maintal! Dazu weiter Frost und weiteren
Schnee mit herrlichem Schneetreiben. Und die üblichen
Begleiterscheinungen: Fußgänger schimpfen über Schnee und Matsch,
genervte Autofahrer, "gestrandete" Fluggäste und liegen gebliebene
Bahnfahrer. Und alle glauben, dass es mit dem Schnee im
menschlichen Handeln ganz normal weiter gehen muss. Hier ist
einfach etwas mehr Geduld und Nachsicht notwendig - der Schnee und
das Eis haben auch außerhalb der Wintersportgebiete ihre schöne
Seiten (z. B. bei einer Wanderung - mit geeignetem Schuhwerk).
Aber der Schnee war nur mit Wolken verbunden, wir hatten über 2
Wochen so gut wie keine Sonne.


Links. Der Main bei Dettingen im Schneetreiben am 26.12.2010.
Rechts: Die Bundesstraße 8 in Dettingen in Richtung Kleinostheim
mit Schnee!
2009


Zu Beginn 2009 kam der Winter, wie ihn die "Klima-Panikmacher" in
den Medien kaum erwartet haben. Nach einem flächendeckenden
Schneefall folgte keine Westfront, die binnen Tagesfrist alles
wieder wegtaut, sondern es blieb kalt und wurde noch kälter. In
Dettingen zeigte das Minimalthemometer 2 m am 07.01.2009 über dem
Boden -18 °C, man kann man Treibeis auf dem Main sehen (siehe oben
zwischen Dettingen und Mainflingen), auch tagsüber waren es immer
noch -6 °C, mit anhaltender Tendenz. Die Stellen in Steinbrüchen,
die ein wenig Wasser führen, werden zu Orten mit schönen
Eiszapfen, die auch mehrere Meter lang werden können. Der Schnee
schmolz nicht, sondern sublimiert (geht also ohne zu schmelzen in
den gasförmigen Zustand über) weg. In den schattigen Ecken wo die
Wintersonne nicht hinkommt, wächst der Schnee, da hier die
Luftfeuchtigkeit als Eis nieder geschlagen wird.
Es ist eigentlich klar, aber wie viele Dinge komplex und schwer
erklärbar. Wenn die Jahresmitteltemperatur um 0,X °C höher oder
niedriger wird, dann ist das die Summenkurve eines Jahres (dann
müsste man noch unterscheiden an einem Ort, viele Orte oder
gemittelt auf eine bestimmte Fläche, z. B. Deutschland). Einzelne
Tage spielen dabei kaum eine Rolle, da es ja bis zum Jahresende
365 Tage sind. Diese Abweichungen sind kaum "fühlbar". Trotzdem
werden mit einer frappierenden Regelmäßigkeiten die vergangen
Monate als "zu warm" beschrieben und die Mittelwerte dann mit dem
Zeitraum verglichen, der zu einem passenden Ergebnis führt. Und es
gibt immer einen Zeitraum, für den der Monat, ein Sommer oder ein
Winter "zu warm" war. Hier wird nach meiner Meinung kräftig
geschönt, was zwar im beschriebenen Fall stimmen mag, aber
hingetrickst ist, da man die Vergleichszeiträume willkürlich
aussucht.

Nach 3 Wochen bitterer Kälte - da werden Erinnerungen an die Werke
niederländischer Maler wach. Der Main bei Aschaffenburg am
16.01.2009 von
der Mainbrücke gegen das Schloss gesehen. Das bis zu 30 cm dicke
(nach Zeitungsaussagen) Eis war tragfähig und so liefen Menschen
übers Eis - man
achte auf den dunklen Streifen quer über den Main (ich wäre da nie
drüber gelaufen). Das mit ca. 1 cm Schnee bestäubte Eis bestand
zunächst aus Eisschollen,
die dann zusammen gefroren sind (eine Art Eisbrekzie). Zuletzt
konnte man dies 1982 und vorher 1980 anschauen. Die Schifffahrt
musste eingestellt werden,
da kein Fortkommen mehr möglich war.

"Schneeengel" mit Halos aus dem Flugzeug auf dem Flug von Mailand
nach
Frankfurt,
aufgenommen am 28.04.2009
Das Licht der hoch (über dem Bildrand) stehenden Sonne wird dabei
an den waagrecht in der Luft schwebenden Eisplättchen in den
Wolken reflektiert (Spiegelung), so dass ein gleißend heller Fleck
entsteht, der als Snowangel (Schneeengel, HELLING 2013:82f)
bezeichnet wird. Die in der Luft befindlichen Eiskristalle brechen
das Licht dieser Erscheinung und erzeugen beiderseits Halos.
*In einem Beitrag in der Zeitschrift "Spessart" von
1980 ist der "Große Stein" in Wenighösbach abgebildet und
daneben und darunter steht zu lesen, dass unsere Gegend
während der letzten Kaltzeit vom Gletschereis bedeckt war und
dass dieser Stein vom Eis hierher transportiert worden wäre
(Anonym 1980:3):

Der Große Stein in Wenighösbach, Kahlgrundstraße bei Haus Nr. 26
aufgenommen am 29.09.2002
Solche Steine, Findlinge genannt, gab es in
Nordeuropa und den Alpen, aber nicht im Spessart. Diese
Erklärung ist nachweislich falsch, denn wir hatten keine
Gletscher, sonder nur einen gefrorenen Boden im
Periglazial.
Bei dem "Stein" handelt es sich um einen Felsen, der am Ort
frei gelegt wurde. Es ist ein
Staurolith-Granat-Plagioklas-Gneis der Mömbris-Formation.
Ähnliche Felsen sind aus Damm und Goldbach bekannt.
Literatur:
Anonym (1980). Aus dem Jahr 1175 stammt die älteste Urkunde, die
Wyngenhosebach erwähnt. Aber schon zwei Jahrtausende vorher wurden
bei Wenighösbach Menschen bestattet.- Spessart Monatsschrift des
Spessartbundes. Zeitschrift für Wandern, Heimatgeschichte und
Naturwissen Heft Juli 1980, S. 3 - 5, 3 Abb., [Druck und Verlag
Main-Echo Kirsch & Co,] Aschaffenburg.
BARRY, ROGER & GAN, THIAN YEW (2011): The Global Cryosphäre.
Past, Present and Future.- 472 p., wenige Abb., teils auf
Farbseiten, [Cambridge University Press] New York.
BENN, DOUGLAS I. & EVANS, DAVID J. A. (1998): Glaciers &
Glaciation.- 734 p,
BENTLEY, W. A. & HUMPHREYS, W. J. (1931): Snow Crystals.- 2nd.
Ed., 226 p, Nachdruck der originalen Ausgabe mit 2453 Abb. von
Schee- und Eiskristallen, [Dover Pulbic.] New York 1995 BOETZKES,
MANFRED, SCHWEITZER, INGEBORG & VESPERMANN, JÜRGEN (Hrsg.)
(1999): EisZeit Das große Abenteuer der Naturbeherrschung.- 283
S., Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung im Roemer- und
Pelizaeus-Museum Hildesheim, zahlreiche Abb., Profile, Karten,
Diagramme, [Jan Thorbecke Verlag] Stuttgart
EDMAIER, BERNARD & JUNG-HÜTTL, ANGELIKA (1996): Eisige
Welten Im Kosmos der Minusgrade.- 160 S., BLV-Verlag
FRAEDRICH, WOLFGANG (1996): Spuren der Eiszeit Landschaftsformen
in Europa.- 184 S.,
GLASER, RÜDIGER (2001): Klimageschichte Mitteleuropas 1000 Jahre
Wetter, Klima und Katastrophen.- 227 S., 71 Abb. als zahlreiche
Diagramme, Fotos., Skizzen und Tabellen, [Primus Verlag]
Darmstadt.
HABEL, M. & Wetteronline [Hrsg.] (2018): Wetterextreme. Eine
meteorologische Weltreise.- 2. Auflage, 217 S., durchweg
großformatige Fotos, [millmari UG Verlag] München.
HELLING, C. (2013): Wolken.- 96 S., viele farb. Abb. als Fotos und
Diagramme, [Primus Verlag] Darmstadt.
HINZ, C. & HINZ, W. (2015): Lichtphänomene Farbspiele am
Himmel.- 216 S., sehr viele farb. und großformatige Abb.,
[Oculum-Verlag GmbH] Erlangen.
HOFMANN, D., PREUSS, G. & MÄTZLER, C. (2015): Evience for
biological shaping of hair ice.- Biogeoscience 12, p.
4.261 - 4.273,
KOBBERT, MAX J. (2017): Diamant und Schneekristall.- 152 S.,
419 überwiegend farbige Abb., mit einer CD-ROM und 3D-Brille im
Nachsatz, [Verlag Dr. Friedrich Pfeil] München.
KUHLE, MATTHIAS (1991): Glazialgeomorphologie.- 241 S., 95 Abb.,
[Wissenschaftliche Buchgesellschaft] Darmstadt
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 218ff, f623f.
MARCINEK, J. & ROSENKRANZ, E. (1988): Das Wasser der
Erde Eine geographische Meeres- und Gewässerkunde.- 318 S.,
NEES, GERHARD & KEHRER, HERMANN (2002): Alzenauer
Wetterchronik Die interessantesten Wetterereignisse in
Alzenau, im Kahlgrund und am Untermain von 365 bis 1999.- 531 S.,
173 Abb., 19 Tab., 3 Karten, [Reinhold Keim Verlag]
Großkrotzenburg
PETRENKO, VICTOR F. & WHITWORTH, ROBERT W. (2002): Physics of
Ice.- 373 p., zahlreiche Fig., Tab., [Oxford University Press]
Oxford GB.
SCHLICHTING, H. J. (2025): Doppelte Sprengkraft.- Spektrum der
Wissenschaft Heft 1/2025, S. 56 - 57, 3 Abb., [Spektrum der
Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH] Heidelberg.
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF [Hrsg.] (2013):
Schnee.- 160 S., zahlreiche Abb., Karten [Wissenschaftliche
Buchgesellschaft] Darmstadt.

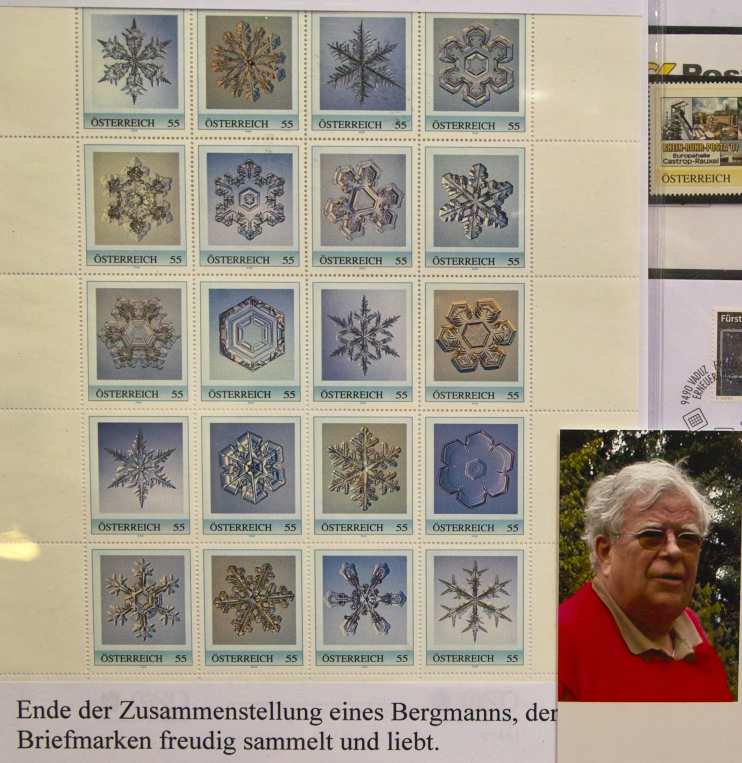
Österreichische Briefmarken mit Schneekristallen aus dem Jahr
2009,
ausgestellt von Niels MAIWEG in einer Ausstellung während der
18.
Mineralienbörse in Ober-Olm bei Mainz am 18.11.2012
(Veranstalter
ist der Georgius Agricola Verein e. V.)
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite