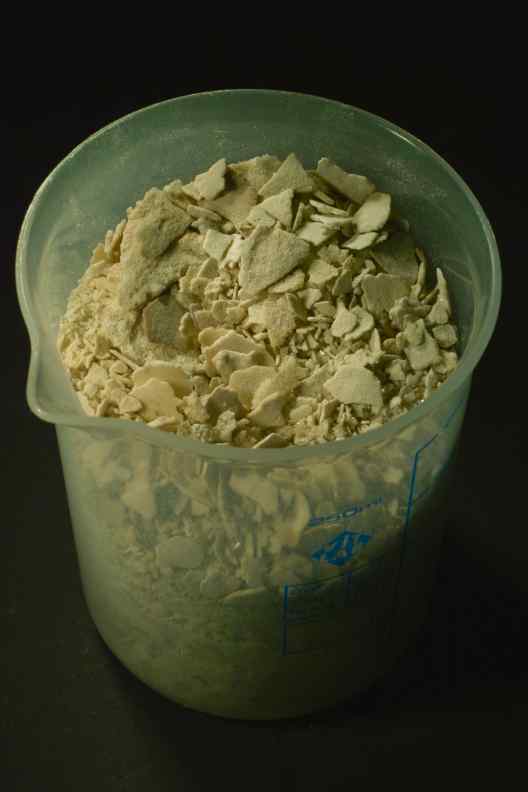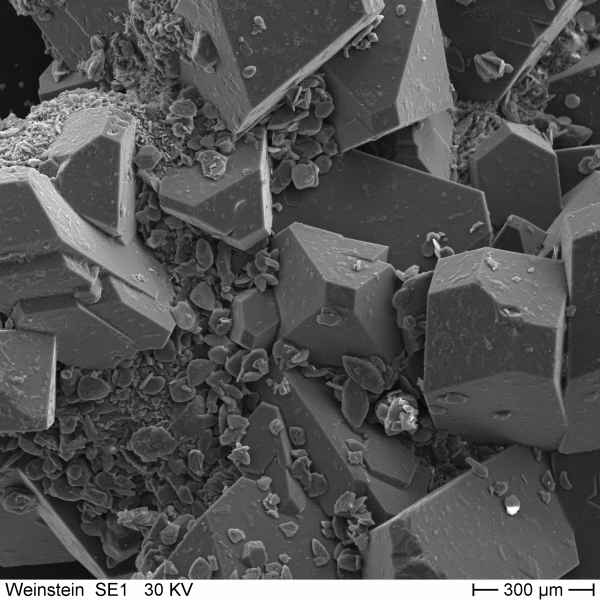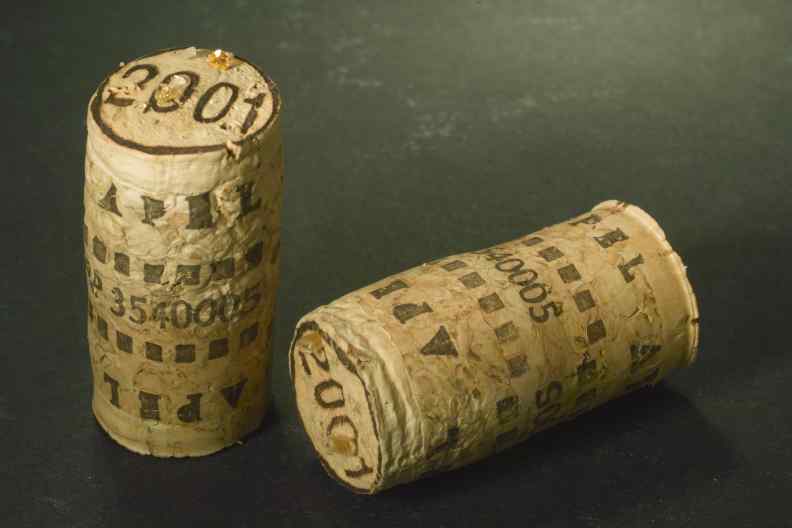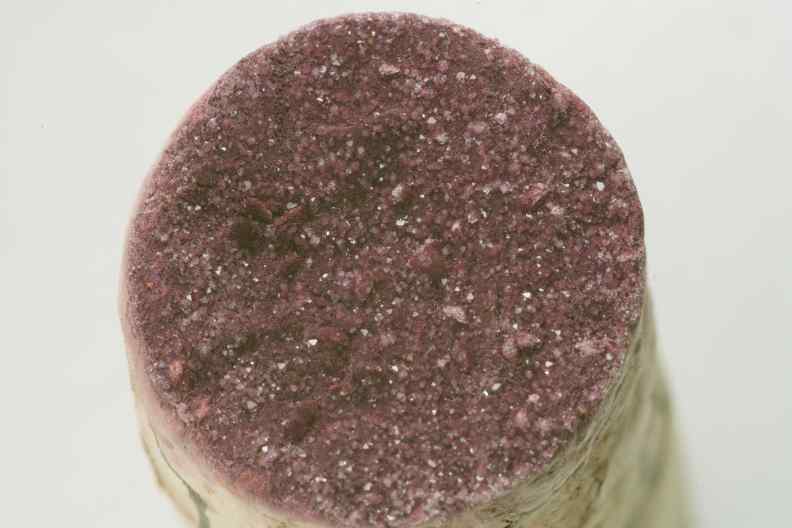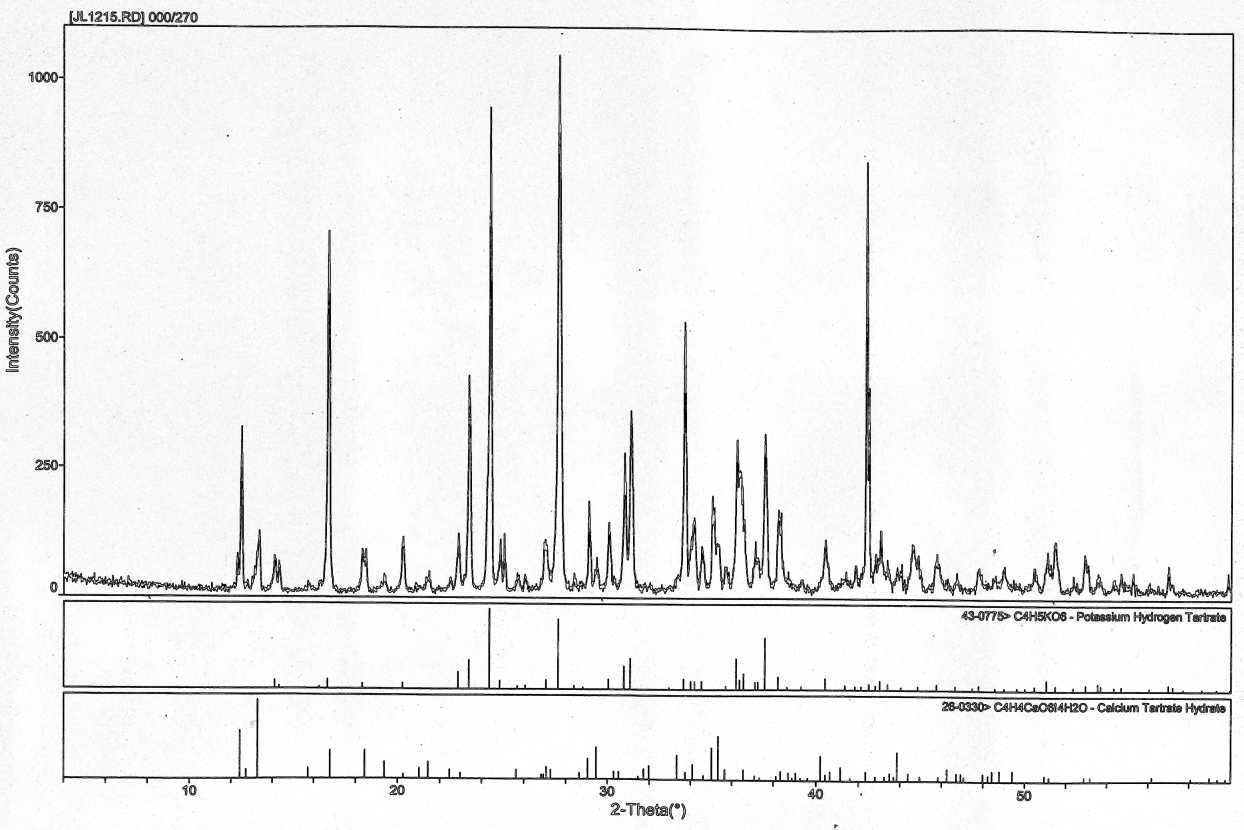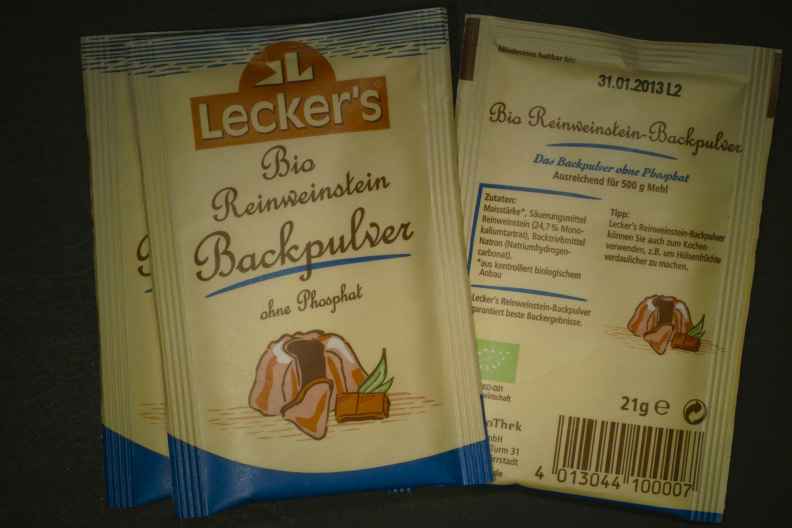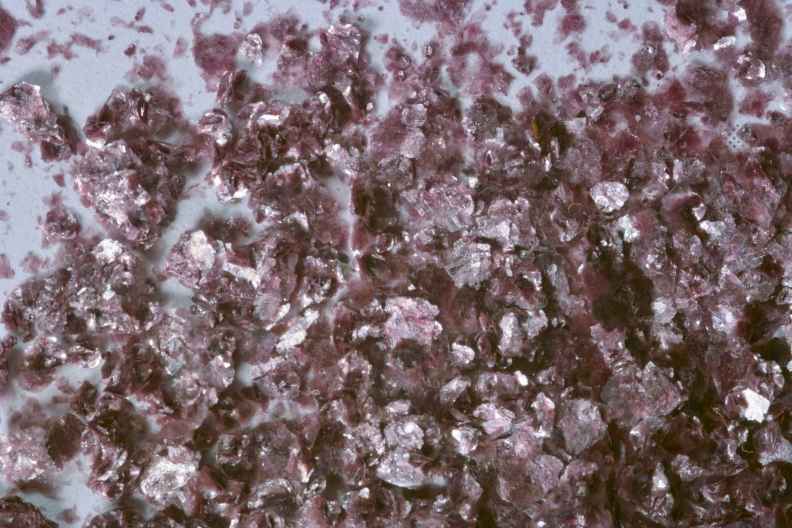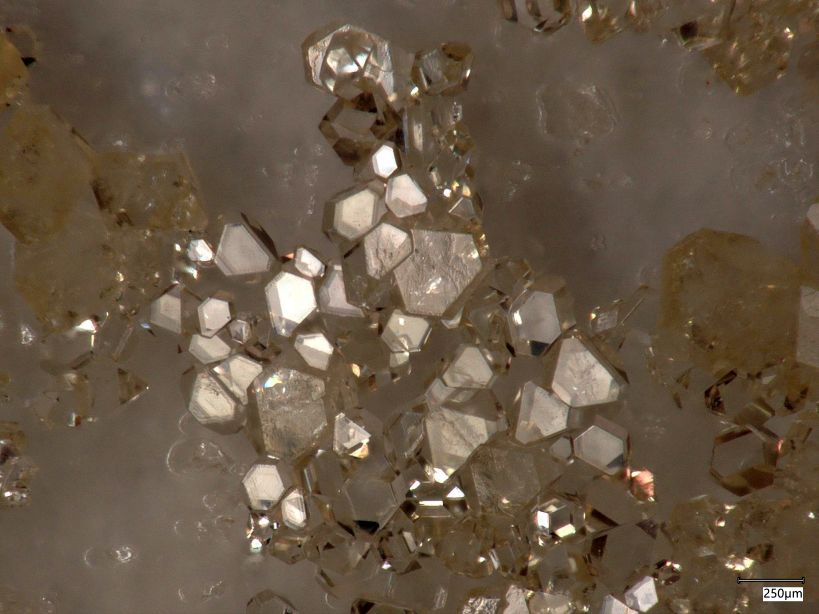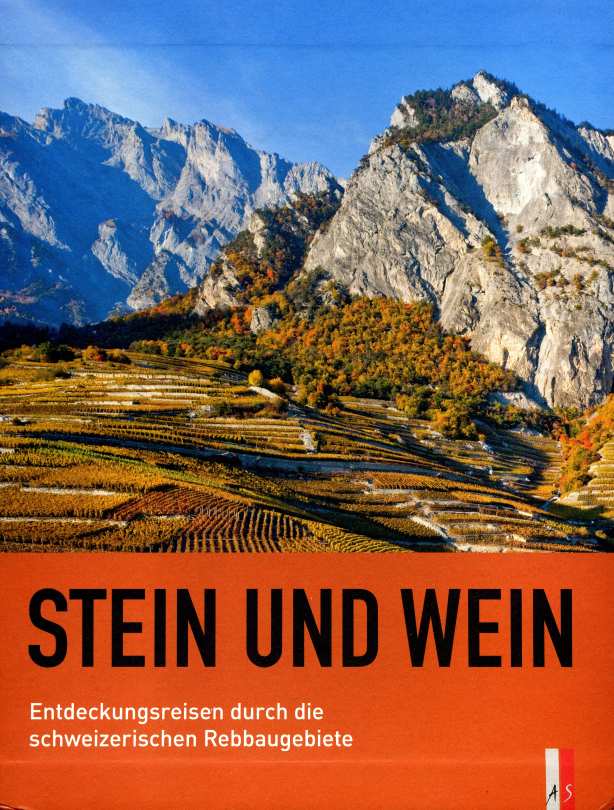Weinstein -
der (unerwünschte)
Stein aus dem Wein.
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main
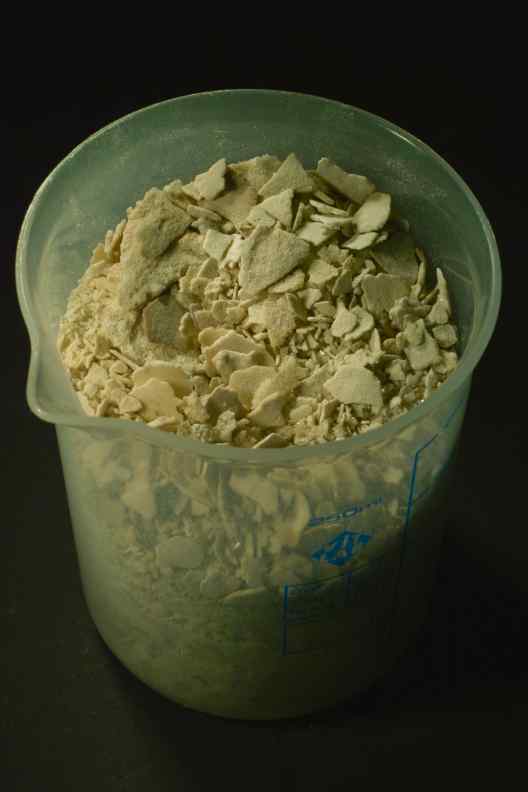
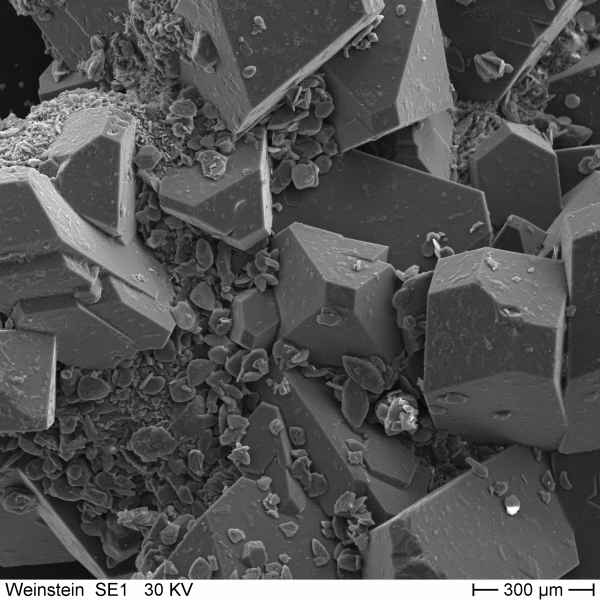
Typische kristalline Krusten des Weinsteins aus
der Weinherstellung im Fass (Hotel Krone Wasserlos),
links Bildbreite 8 cm, erhalten aus einem Weingut in
Wasserlos.
Rechts ein winziges Stückchen der Krusten unter dem
Rasterelektronen-Mikroskop (REM):
Die großen Kristalle bestehen aus Calcium-Tartrat,
die kleinen Blättchen dazwischen sind das
Kalium-Hydrogen-Tartrat, Bildbreite 1,5 mm,
REM-Foto von Stefan DILLER, Würzburg.
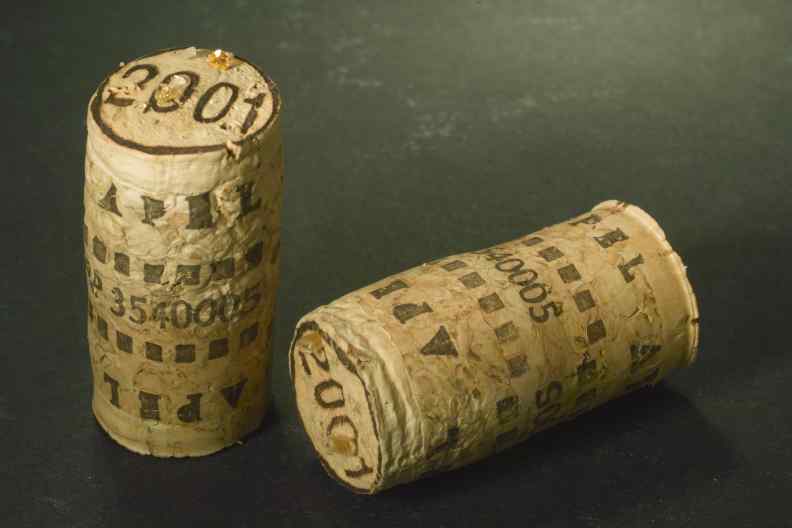

Cognacfarbene, durchsichtige
Weinstein-Kristalle am Korken,
Elbling von der Mosel, Jahrgang 2001,
Bildbreite ca. 6 cm, im Ausschnitt rechts 3 mm
Mineraliensuche in der Weinflasche:


Der Weintrinker kennt die typischen Kristalle auf der Unterseite
der Korken,
Bildbreite 2 cm, rechts im Detail 1,5 mm
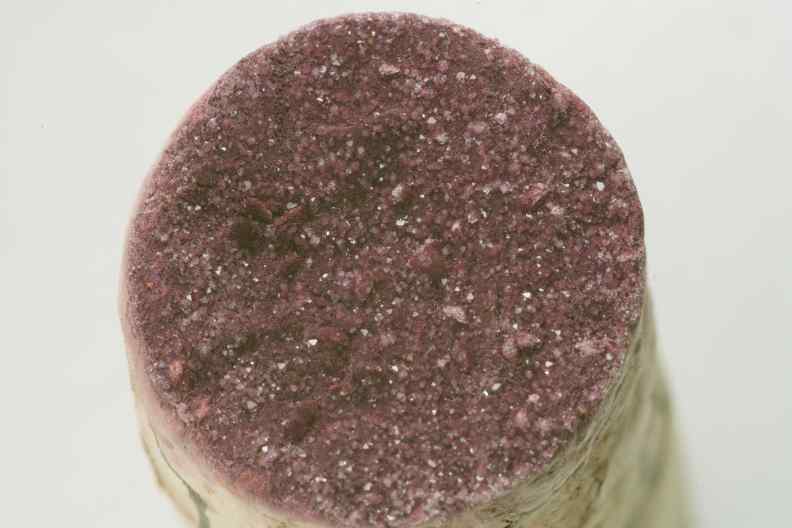

Bei den Rotweinen sind die Kristalle des Weinsteins violett und
rot;
Bildbreite 2 cm, rechts im Detail 1,5 mm
Entstehung
Es handelt sich beim Weinstein um die Salze der Weinsäure. Die
Weinsäure ist eine organische Säure mit sehr komplexer chemischer
Zusammensetzung (2,3-Dihydroxibernsteinsäure, vier verschiedene
Formen durch Rechts- und Linksstrukturen, an denen der
französische Chemiker Louis Pasteur (1822 - 1895) die Ideen zur
modernen Vorstellung der räumlichen Struktur entwickelte). Diese
schmecken angenehm stark sauer. An der Luft verbrennen die
Weinsäurekristalle unter Entwicklung von Karamelgeruch. Zerreibt
man die Kristalle bei adaptiertem Auge in völliger Dunkelheit, so
ist ein Leuchten zu beobachten (Triboluminiszenz; bedeutet
Reibungsleuchten).
In den Zellen der Pflanzen ist je nach Art neben Wasser und
zahlreichen organischen und anorganischen Verbindungen auch die
Weinsäure enthalten. Bei der Gewinnung der flüssigen
Bestandteile aus den Früchten - in der Regel durch mechanisches
Pressen - gelangen diese in den Saft. Aufgrund der komplexen
Stoffgemische reagieren die Komponenten im Saft miteinander, so
dass es zur Bildung von Salzen kommen kann. Der Chemiker
bezeichnet diese Salze der Weinsäure als Tartrate - so wie man die
Salze der Kohlensäure als Carbonate kennt; das einfachste Beispiel
ist das Calciumcarbonat, der gewöhnliche Kalk.
Die Pflanzen erzeugen beim Stoffwechsel Weinsäure und die ist in
geringen Mengen in vielen Früchten, wie zum Beispiel in der
Weintraube, aber auch in der Stachelbeere, der Johannisbeere, in
vielen weiteren Obstsorten, aber auch in der Zuckerrübe, im
Löwenzahn oder in Lindenblüten enthalten. In unserer Region
dominieren die Kalium- und Calcium-Tartrate, zum Teil sind diese
auch Wasser-haltig, d. h. es ist im Kristallgitter Wasser fest
eingebaut. In der Regel handelt es sich beim Weinstein aus dem
Wein um die Salze:
- Kaliumhydrogentartrat (KC4H5O6)
- Kaliumbitartrat
(K2C4H4O6·½H2O)
- Calciumtartrat
(CaC4H4O6)
- Calciumhyrogentartrat (CaC4H4O6·4H2O).
Die Farbe der Kristalle ist bei Weißweinen farblos, bei Rotweinen
rot, rötlich oder violett. Meist sind es gedrungene, oft nur
wenige Millimeter große Kristalle; es kommen aber auch nadelige
Formen vor. Der Weinstein ist für den Menschen nicht
schädlich oder gar toxisch und verursacht keine geschmacklichen
Beeinträchtigungen im Wein. Die Krusten in den Fässern sind meist
hell- bis dunkelbraun und besitzen einen Aufbau, der an
Kalksinterbildungen der Höhlen im Kalk erinnert. Aber es gibt auch
große Krstalle, siehe bei den Abbildungen unten.
Und warum wachsen die Kristalle des Weinsteins (Tartrate)
bevorzugt am Korken?
Zur Bildung von Kristallen benötigt man einen Kristallkeim. Das
sehr glatte und völlig saubere Innere einer gläsernen Weinflasche
bietet keine guten Bedingungen für das regelmäßige Anlagern zu
einem Kristall (das Glas ist amorph), der raue und chemische
völlig anders zusammen gesetzte Kork dagegen schon. So ist die
raue Fläche des Korks der Keim ("Starter") für das
Kristallwachstum. In den Flaschen mit Schraubverschluss bilden
sich oft kleine Kristalle, die lose in der Flasche liegen und erst
wahrgenommen werden, wenn man die Flasche völlig leert und den
Bodensatz mustert.
Die kleinen, stark funkelnden Kristalle (engl. wine
diamonds, tartraic crystals, tartaric acid, cream of tartar,
wine stone) in den Flaschen oder an der Korken (wenn noch
einer in der Flasche ist; zunehmend sind des Schraubverschlüsse
oder Glasstopfen) regen zu interessanten Betrachtungen an.
Entgegen der üblichen Meinung scheint es so zu sein, dass der
Weinstein unabhängig vom Boden gebildet wird; vermutlich übt die
Pflanze bzw. die Rebsorte einen größeren Einfluss auf die Art und
Menge des Weinsteins aus.
Der Weinstein war übrigens bereits den Griechen und Römern
bekannt. Die chemische Darstellung des Weinsteins als
Kaliumbitartrat gelang erstmals 1769 dem schwedischen Chemiker
Carl Wilhelm SCHEELE (1742 - 1786; ihm zu Ehren wurde ein
Wolfram-Mineral als Scheelit benannt). Der Bergbaufachmann und
Arichitekt Franz Ludwig von CANCRIN
zählte den Weinstein zu den Mineralien (CANCRINUS 1773:75); dies
wird heute nicht mehr so gesehen, da es sich bei den Kristallen in
den Flaschen und Fässern nicht um eine natürliche Bildung handelt.

Silbrig-grauer Weinstein (Kalium-Hydrogen-Tartrat) aus stark
glänzenden Blättchen aus einem Rotwein (erinnert an Hämatit),
Bildbreite 2 cm
Ob das Terroir (Autorenkollektiv 2018) den Weistein bzw. seine
Bildung beeinflusst, konnte nicht sicher nachgewiesen werden.
EYRICH (2004/2006) konn durch seine Analysen mainfränkischer
Weinsteine und deren Böden eine geringe Abhängigkeit der
Weinsteinzusammensetzung von der Calcium- und Kaliumkonzentration
des Bodens aufzeigen. Dabei wurde belegt, dass die Kaliumgehalte
des Bodens mit ca. 3 % K2O keine großen Schwankungen
unterliegen, ganz im Gegenstatz zu den Calciumgehalten, die von
weniger als 1% bis auf über 20 % CaO schwanken können
(Buntsandstein versus Muschelkalk). Hier spielt dann die selektive
Aufnahme der Pflanze die entscheidende Rolle.
Der Weinstein kann auch bereits im Traubensaft (dann
"Traubenstein" genannt) ausfallen, also ohne Gärung - siehe unten.
Dies gilt auch für andere Säfte; hier werden diese Neuschöpfungen
nicht so beachtet wie beim Wein oder einfach mit Zucker
verwechselt.
Die Herkunft des Weines kann man unter besonderen Umständen
schmecken, was mit dem Begriff Terroir verbindet. Man könnte auch
sagen, dass man die Geologie im Weinglas betreibt, eine sehr
leichte und wenig anstrengende Sonderform dieser Wissenschaft*.
Welcher Weinstein ist das?
Untersucht man diese kristallinen Substanzen, so erhält man
mittels Röntgenbeugung ein Diagramm, das man hinsichtlich der
Substanzen auswerten kann. So kann man relativ einfach ermitteln,
welche Salze am Aufbau der Krusten beteiligt oder welcher Natur
die Kristalle sind. Die Auswertung eines solchen Beugungsmusters
erfolgt in der Regel mit einem PC und einer Datenbank, in der alle
kristallinen Substanzen verzeichnet sind. Damit lassen sich dann
auch mehrere, ganz unterschiedliche Phasen in einer sehr kleinen
Probenmenge sicher bestimmen.
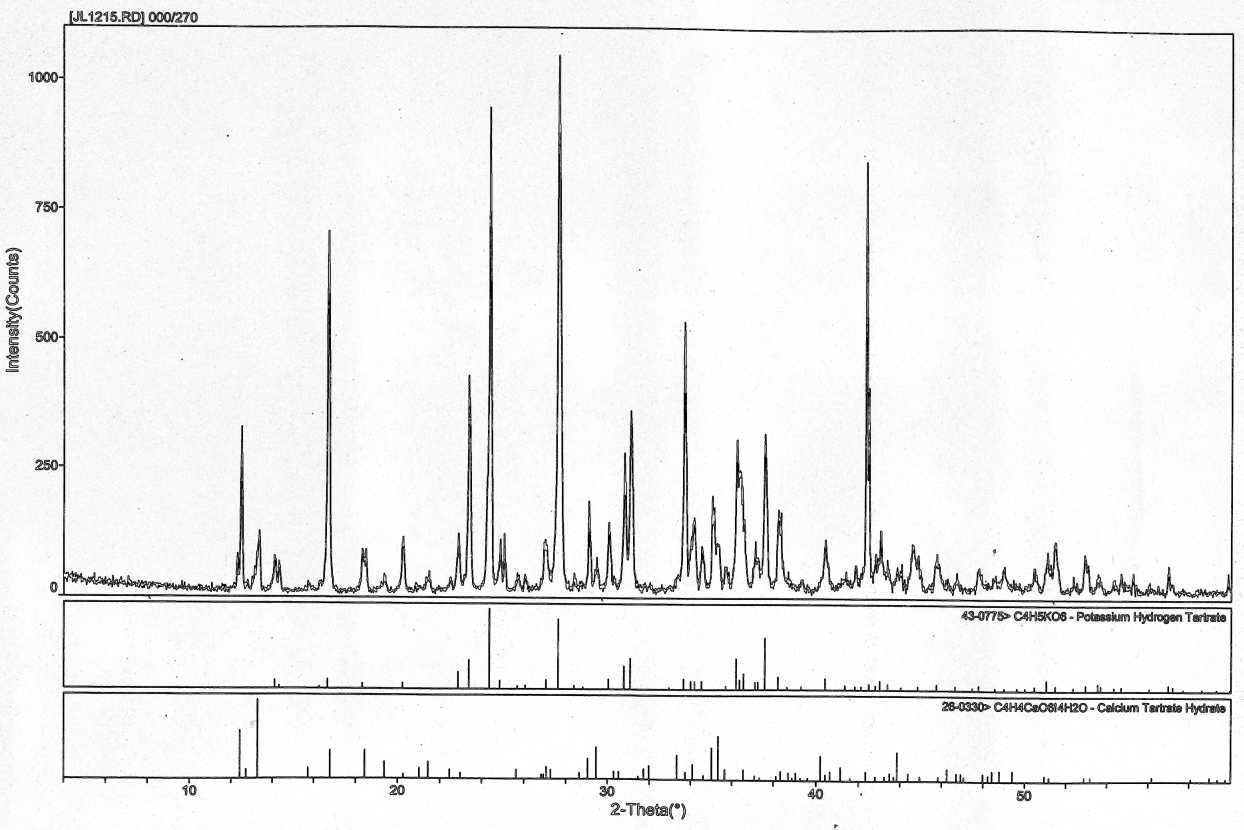
Beugungsmuster nach einer Röntgenuntersuchung eines Weinsteins
(Probe 000/270)
Doch wenn mehrere Arten Weinstein als Stoffgemisch in den
Krusten vorliegen, dann weiß man nicht welche Kristalle wie zu
benamen sind. Hier hilft das Rasterelektronenmikroskop mit einem
Nachweisverfahren (EDX) weiter. Dabei kann man die schweren
Elemente am Aufbau selbst kleinster Kristalle ermitteln und so die
Ergebnisse aus der Röntgenbeugung präzisieren.


In den Holzfässern für den Wein bildeten sich im Laufe der Jahre
dicke Krusten des Weinsteins. Im linken Bild ist das Stück einer ca.
2,5 cm
dicken, braunen Kruste zu sehen (Bildbreite 17 cm), rechts im
Ausschnitt erkennt man die undeutlich ausgebildeten Kristalle der
blumenkohl-
artigen Oberfläche (Bildbreite 2 cm). Das eindrucksvolle Stück wurde
im Juli 2011 von Herrn Günther Wohlfahrt, Weinbergsmeister am
Juliusspital in Würzburg, zur Verfügung gestellt.
Heute wird der Weinstein insbesondere durch Abkühlen und dem Zusatz
von Ca-Ionen (TEGETHOFF 2001:311) bei der Weinzubereitung gefällt
(siehe Bild ganz oben) und so sind heutige Fässer - meist aus
nichtrostenden Chrom-Nickel-Stählen - blank und besitzen keine
Krusten aus Weinstein mehr. Damit vermeidet man die Verkeimung im
Weinfass. Und der Weinstein in den Flaschen und an den Korken werden
immer seltener.
Der so gewonnene Weinstein wird als natürliches Backtreibmittel
("Backpulver") raffiniert und abgepackt (z. B. Lecker´s
Bio-Reinweinstein Backpulver enthält hauptsächlich
Kalium-Hydrogen-Tartrat und dazu
Natrium-Hydrogen-Carbonat). Dazu werden die im Weinbau
anfallenden Weinsteinmassen von spezialisierten Betrieben der
chemischen Industrie aufgekauft.
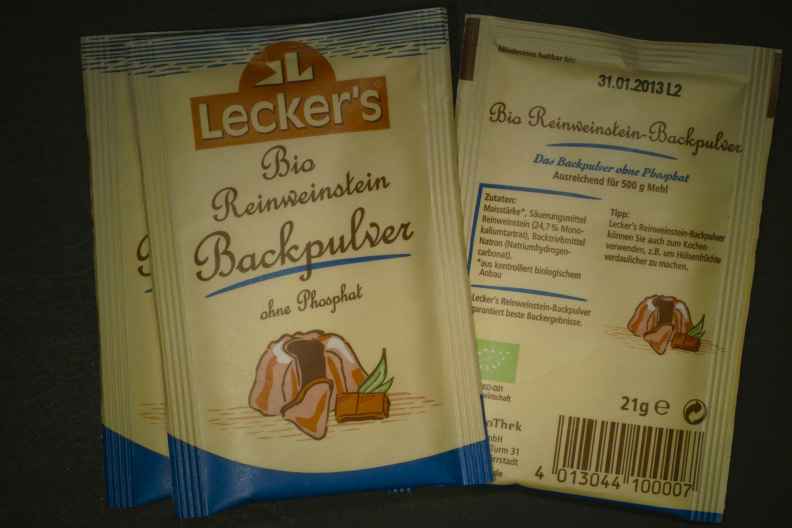
Weinstein als Backtreibmittel aus dem Lebensmittelhandel.
Weiter werden die Substanzen dieser Gruppe in der
Getränkeherstellung, der Galvanik beim Verzinnen und Vergolden und
in Poliermitteln verwandt. Eine Besonderheit ist Schmuck, bei dem
Weinstein in Edelmetall gefasst wird. Und man braucht es zum zur
Stabilisierung von Eischnee (Erhöhung der Temperaturbeständigkeit
und dem Erhalt der Fülle), zur Stabilisierung von Schlagsahne
(Erhaltung der Textur und des Volumens), zur Verhinderung der
Kristallisation von Zuckersirup und zur Vermeidung der Verfärbung
von erhitzem Gemüse. In der Pharmazie stellt man aus Weinstein das
Seignettesalz (KNaC4H4O6·4H2O,
ein Brechmittel) her. Eine ähnliche Verbindung ist der
Brechweinstein (Kaliumantimon(III)-oxid-tartrat).
Der lange in Kitzingen wirkende Apotheker und Alchemist Johann
Rudolph GLAUBER (*10.03.1604 in Karlstadt 16.03.1670 in Amsterdam)
verstand es in größeren Mengen Weinstein zu erzeugen und damit zu
handeln. Er schrieb zahlreiche Veröffentlichungen als Bücher,
produzierte eine ganze Reihe von Chemikalien und gilt deshalb als
einer der Begründer der frühen Chemie-Industrie.
Weinstein wurde bereits im 18. Jahrhundert als Reagenz bei Probieren
der Kupfererze verwandt (CANCRIUNS 1766:31).
Der sehr treffende Name Weinstein stammt einfach von dem Vorkommen
eines "Steins" aus dem Wein:
- Weinstein ist in der Chemie als Trivialname immer noch
übliche Begriff; es existieren auch Kombinationen wie z. B.
Brechweinstein (Autorenkollektiv 1908:487f).
- Weinstein ist der Name von Weinstuben (z. B.
Heidelberg), Restaurants (z. B. Kiel), Bistros
(z. B. Fell), Weinhandlungen (z. B. Emden), Ferienwohnungen
(z. B. Berkastel-Kues), Cafes (z. B. Bad Traunstein), Museen
(z. B. ehemals Herrstein) und Weingütern (Ellmedingen).
- Weinstein wird als der Name von Produkten wie
Backpulver. Pigmente, Scheuerpulver, Vino Weinstein
Tischdekorationen oder Schmuck verwandt.
- Weinstein ist auch als Familienname - und damit auch
als Firmenname - weit verbreitet, aber mit nur etwa 600
Personen in Deutschland doch ein seltener Nachname. Er ist aus
dem 14. Jahrhundert erstmals überliefert (BAHLOW 1967:539 als
Michale Weinstein) und wurde vom Beruf des Krämers übernommen,
der Weinstein verkaufte. Es ist damit ein sehr alter Nachname.
Es gibt aus diesem Grund eine sehr umfangreiche Liste mit
Schriften und Büchern des Autorennamens Weinstein.
- Weinstein ist Bestandteil mathematischer Methoden, z.
B. Weinstein-Bazley-Fox-Verfahren.
- Weinstein gibt es als geographische Bezeichnung, z. B.
Schloss Weinstein in Marbach.
- Weinstein ist auch der Name von Pseudonymen, die unter
dem Namen Kriminalromane publizieren, z. B. von Zeus Weinstein.
- Weinstein ist der Name von Erlebnisveranstaltungen mit
Wein (z. B. in Paffenweiler).
- Weinstein wird als Wortspiel verwandt, meist in
Verbindung mit Wein, z. B. vom Weingut am Stein in Würzburg oder
WeinStein-Kiste für hochwertige Weinverpackungen.
- Weinstein als Allegorie auf steinerne Zeugnisse des
Weinbaus (z. B. OBERSTE-LEHN 2001).
- Weinstein wird in vielen Varianten als Name für Internetdomains
verwandt, z. B. Wein-Stein.info
Und die allwissende Suchmaschine Google findet 17,2 Millionnen mal
den Begriff Weinstein im Internet ...
Der Name gehört zu einer ganzen Gruppe von Namen, die mit dem Wein
zusammen hängen: Weinberger, Weinbrenner, Weindl, Weingarten,
Weinholtz, Weinkeuf, Weinmann, Weinerber, Weinrich, Weinriefer,
Weinschenk, Weinstock, Weintraut, Weinzierl (DUDEN 2005:707f).

Reife rote Trauben am Weinstock im Weinberg in Lengfurt
(Triefenstein),
aufgenommen am 30.09.2012
Bilder vom Weinstein:

Aber Weinstein (Kaliumhydrogentartrat) kann auch ohne
Weinzubereitung aus dem Traubensaft roter Trauben ausfallen
("Traubenstein"). Die schuppigen Krusten stammen aus
Trauben, die 2011 in Schöllkrippen wuchsen,
Bildbreite 2 cm.
|

Nach dem Genuss eines 2006er Herxheimer Himmelreich Riesling
Auslese von G. PETRI fand sich am Flaschenboden ein weißer
Weinstein in Blumenkohlform mit farblosen, säuligen
Kristallen (im Bild nicht zu erkennen),
Bildbreite 2 cm |

Hellgelbe, tafelige und mit ca. 1,5 cm extrem große
Weinsteinkristalle in einer Weinflasche des Granatiums in
Radentheim in Kärnten (Österreich). Gesehen in einer
Sammlervitrine zwischen Granat (wohl Almandin) auf den
Münchner Mineralientagen (Munich Show) im Halle A5,
aufgenommen am 27.10.2012.
|

Bemerkenswerte Platte aus einem Weinstein mit großen
Kristallen aus einem Holzfass der ehemaligen Weinkellerei
Häfelin in Neustadt, entdeckt um 1970, gesehen in der
Naturschatzwand des Pfalzmuseum für Naturkunde -
POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim am 20.03.2014
Bildbreite ca. 15 cm
|

Zwei verschiedene Weinstein-Kristalle auf einem Korken eines
Prosecco Veneto 2011. Die kleinen, farblosen Kristalle
bestehen aus dem Calcium-Tartrat, die großen Kristalle sind
aus einem Kalium-Tartrat,
Bildbreite 2 cm. |

Traubenstein (Weinstein) aus Fässern der Gemeinde Tramin an
der Weinstraße in Südtirol,
Bildbreite links 7 cm.
|

Traubenstein (Weinstein) aus Fässern der Gemeinde Tramin an
der Weinstraße in Südtirol,
Bildbreite 15 cm.
|

Tetragonale, funkelnd-farblose Weinstein-Kristalle
("Wein-Diamanten") aus einem kleinen Bocksbeutel eines
"Spessart-Schoppen" vom Weinhandel Bender in Mömbris,
Bildbreite 2 cm. |

Weinstein aus einem Rotwein "Domina" des Weinguts Gerhard
STÜHLER aus Schöllkrippen,
Bildbreite 3 cm
|
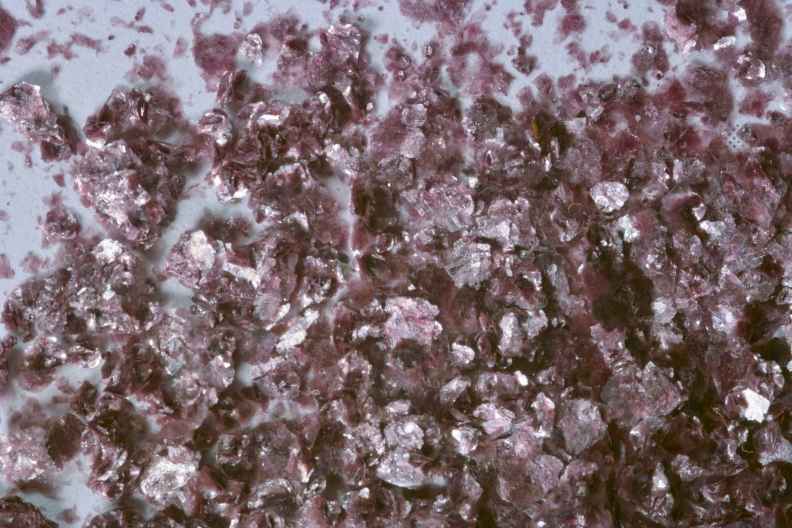
Blättchenförmige Weinstein-Kristalle aus einem 2012er
Thüngersheimer Scharlachberg vom Weingut Schwab. Es ist der
Rest im Weinglas eines schönen Abends in der Weinhaus
Mehling in Lohr am 15.04.2016
Bildbreite 2 cm
|

Ca. 40 x 20 cm große und mit etwa 1 cm relativ dünne Platte
aus Weinstein als Ablagerung aus einem Weinfass, ausgestellt
im Heimatmuseum im Klingenberg a. Main,
aufgenommen am 11.10.2014 |

Große isolierte Kristalle aus Weinstein, zur Verfügung
gestellt vom Weingut Simon in Wasserlos,
Bildbreite 5 cm
|

Große Weinstein-Platte aus einem Holzfass. Die hier gezeigte
Rückseite bildet die Struktur des angelösten Holzes der
Bretter des Fassbodes oder -deckels ab. Das Stück stammt aus
der
ehemaligen Mineraliensammlung von Reinhold FRANZ
(*22.04.1931 †24.01.2017) aus
Obernau,
Bildbreite 17 cm
|

Da kann man schon an Wein-"Diamanten" denken. Weinstein
eines 1996er Klingenberger Schlossberg Portugieser in zwei
unterschiedlichen Kristallen,
Bildbreite 2 mm.
Der Weinstein stammt vom Mineraliensammler Werner STROBEL
(*09.03.1946 †22.03.2021) aus Wörth. |

Bruchfläche eines Weinsteins aus einem Gefäß, welches
zunächst für Weißwein und zum Schluss für Rot- oder Roséwein
benutzt wurde. Das Stück stammt aus einer
Mineraliensammlung in Kahl am Main,
Bildbreite 4 cm
|

Nadeliger Weinstein als sternförmige Kristallaggregate von
einem 2003er Wein aus Obernburg,
Bildbreite 3 mm
|

Roter Weinsteine eines 2003er Klingenberger Schlossberg
Kreation in Rot.
Bildbreite 3 mm |
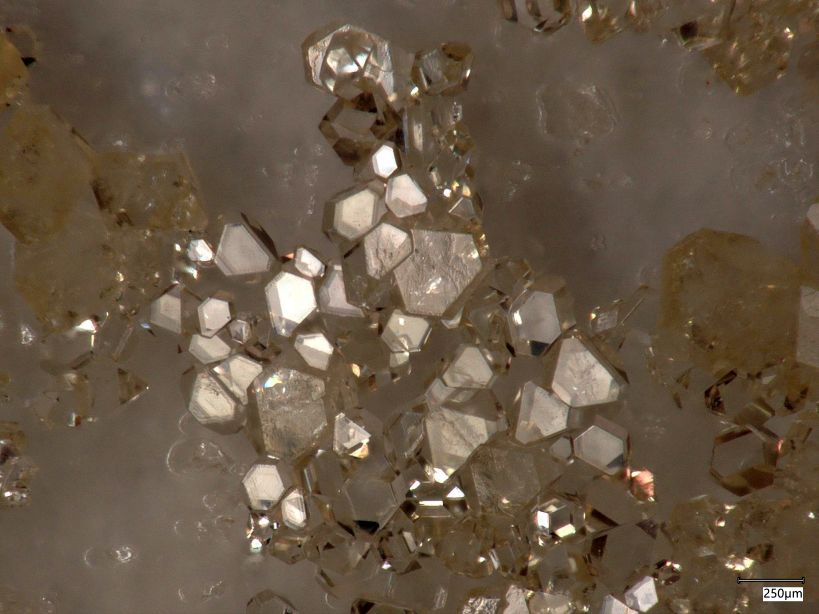
Kleine Weinstein-Kristalle mit gleichsinniger Orientierung
aus einer Flasche Bürgstadter Centgrafenberg Burgunder,
Bildbreite 3 mm
|

Weinstein-Kristall an einem größeren Kristall, lose aus
einer Flasche Rotkäppchen-Sekt um 1999, aus der Sammlung von
Peter GROH(†), Beerfelden,
Bildbreite 3 mm
|

"Oktaedrischer" Weinstein-Kristall auf einem Korken
gewachsen, aus einem pfälzischen Blauen Spätburgunder von
1995, aus der Sammlung von Peter GROH(†), Beerfelden,
Bildbreite 6 mm |
|
Literatur:
Autorenkollektiv (1908): Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein
Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens.- 6. gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage, 20. Band Veda bis Zz, 1055 S., zahlreiche
Abb., Tab., Karten, Tafeln, [Bibliographisches Institur] Leipzig
& Wien.
Autorenkollektiv (2018): Terroir: Science Related to Grape and Wine
Quality.- Elements. An International Magazine of Mineralogy,
Geochemistry, and Petrology, Volume 14, Number 3, June 2018, p. 145
- 216, viele farb. Abb., Mineralogical Society of America, USA.
DECROUEZ, D., FINGER, W., HALDIMANN, P.,
HOFSTETTER, J.-C., KÜNDIG, R., MEYER, C.,
MUMENTHALER, T., SIEBER, N., SPESCHA, R.,
TESTAZ, G. und 60 weitere Autoren (2018): Stein und Wein.
Entdeckungsreisen durch die Schweizerischen Rebbaugebiete.- Buch 240
S. und 10 Regionalhefte mit je etwa 30 S. in einem Schuber aus
Karton, sehr viele farb. Abb. als Fotos, Karten, Diagramme, Profile
und Zeichnungen, Hrsg. vom Verein Stein und Wein, [AS Verlag &
Grafik] Zürich.
BAHLOW, H. (1967): Deutsches Namenlexikon. 15000 Familien- und
Vornamen nach Ursprung und Sinn erklärt.- 576 S., ohne Abb.,
[Keyser´sche Verlagsbuchhandlung GmbH] München.
BOTTLER, P. (1921): Die Alkalien Darstellung der Fabrikation von
Kali, Weinstein, Pottasche.- 408 S., 57 Abb., [Hartleben Verlag]
Wien.
CANCRIUNS, F. L. (1766): Practische Abhandlung von der Zubereitung
und Zugutmachung der Kupfererze nach ihrem ganzen Umfang.- 156 S.,
ohne Abb., [Andräische Buchhandlung] Frankfurt am Main.
CANCRIUNS, F. L. (1773): Erste Gründe der Berg und Salzwerkskunde.
1. Teil Mineralogie.- 272 S., mit Register, [Andräische
Buchhandlung] Frankfurt am Main
DITTMAR-ILGEN, H. (2007): Kristalle im Weinglas. (Weinstein bei der
Weinherstellung), S. 37.- In: Wie der Kork-Krümel ans Weinglas
kommt. Physik für Genießer und Entdecker, [Hirzel] Stuttgart.
DUDEN (2005): Familiennamen. Herkunft und Bedeutung von 20 000
Nachnamen.- 969 S., zahlreiche SW-Abb. im Text, [Bibliographisches
Institut GmbH] Berlin. EYRICH, R. (2004/2006): Weinsteinanalyse in
Relation zu charakteristischen Böden der Trias- Formation.-
unveröffentlichte Facharbeit des CJT- Gymnasium Lauf a.d. Pegnitz,
40 S.,
FALBE, J. & REGNITZ, M. [Hrsg.] (1992): Römpp Chemielexikon. 3.
Band H - L.- 9. Auflage, S. 2130f,
FALBE, J. & REGNITZ, M. [Hrsg.] (1992): Römpp Chemielexikon. 6.
Band T - Z.- 9. Auflage, S. 5025f,
HAMMER, V. F. (2001): Steinwein ... ... Weinstein. Ein Streifzug vom
Wein zum Stein.- Lapis 26 Nr.5, S. 15 - 22, 26 farb. Abb.,
[C. Weise Verlag] München.
HARTMANN, E. (1832); Ueber die Darstellung eines reineren
Weinsteins.- Inaugural-Dissertation welche zur Erlangung der
Doctor-Würde in der Medicin und Chirurgie unter dem Präsidium von C.
G. Gmelin im März 1832 der öffentlichen Prüfung vorgelegt, 14
S., ohne Abb., [C. H. Reiss] Tübingen.
GLAUBER, J. R. (1654): Gründliche und warhaftige Beschreibung, wie
man auß der Weinhefen einen guten Weinstein in großer Menge
extrahiern soll.- 25 S., ohne Abb., [in Verlegung Wolffgang des
Jüngern und Johann Andreæ Endter] Nürnberg.
KLING, M., SCHÄTZLEIN, C. (1923): Die Verwertung der Weinrückstände.
Anleitung zur Verwertung von Weintrestern, Weinhefe und Weinstein
einschließlich der Erzeugung von Kognak, Weinbrand und Weinsprit.
Mit einem Anhang: Die Verwertung der Rebentriebe und des Rebholzes.-
Chemisch-technische Bibliothek. VIII, 272 S., [Hartleben Verlag]
Wien & Leipzig.
LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte
Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 46 - 47, 4 Abb., - in Karlsteiner
Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom
Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.
LOWITZ, TOBIAS (1788): Über die Bereitung der wesentlichen
Weinsteinsäure aus rohem Weinstein.- in Beyträge zu den chemischen
Annalen, Hrsg. von Lorenz Crell. Band 3 (von 6) 498 S., [J. G.
Müller] Helmstedt.
MILDENBURGER, J. (1997): Anton Trutmanns „Arzneibuch“. Teil 2.
Wörterbuch. Bd 5. W – Z, S. 2300 – 2301, Würzburger
medizinhistorische Forschungen. Band 56, 5. [Königshausen und
Neumann] Würzburg.
OBERSTE-LEHN, G. (2001): Pfälzer Weinsteine. Thema und Variationen.-
Band 5, 1. Auflage, 256 S., mit zahlr. SW-Abb., Hrsg.: Weinfreunde
Wachenheim an der Weinstraße e.V., [Englrahm & Partner] Haßloch.
PIAZ, d. A. (1885): Die Verwerthung der Weinrückstände : Praktische
Anleitung zur rationellen Verwerthung von Weintrester, Weinhefe
(Weinlager, Geläger) und Weinstein.- Chemisch-technische
Bibliothek - Band 27, XVI, 192 S. mit 23 Abb., [Hartleben Verlag]
Wien.
PICK, S. (1894): Die Alkalien. Darstellung der Fabrikation der
gebräuchlichsten Kali= und Natron= Verbindungen, der Soda, Potasche,
des Salzes, Salpeters, Glaubersalzes, Wasserglases, Chromkalis,
Blutlaugensalzes, Weinsteins, Laugensteins u. s. f. deren Anwendung
und Prüfung.- 2.verbesserte Aufl., VIII, 399 Seiten, 57 Abb. davon 2
Abb. auf ausklappbarem Blatt im Anhang, Tab., [A. Hartleben
Verlag] Wien, Pest. Leipzig.
RENGGLI, C. & ARMBRUSTER (2011): Weinstein - ein besonderer
Kristall.- Schweizer Strahler.- 45. Jahrgang, Heft 1/2011,
Februar, S. 27 - 30, 6 Abb., Schweizerische Vereinigung der
Strahler, Mineralien- und Fossiliensammler SVSMF,
SITTLER, C. (1995): "Wein auf Stein" oder "Vom Stein zum Wein"
Beziehung von Rebsorte zu Gesteinslage und Wein-Eigenart im Gebiet
Barr-Andlau (Lesaß, Frankreich) (Exkursion J am 21. April 1995).-
Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen
Vereins Neuer Folge 77, 5 Abb., 3 Tab., [E.
Schweizerbart´sche Verlagsbuchhhandlung] Stuttgart.
STEISKAL, K. (1894): Die Alkalien. Darstellung der Fabrikation der
gebräuchlichsten Kali- und Natron-Verbindungen, der Soda, Potasche,
des Salzes, Salpeters, Glaubersalzes, Wasserglases, Chromkalis,
Blutaugensalzes, Weinsteins, Laugensteins u.s.f., deren Anwendung
und Prüfung.- VIII, 399 Seiten; mit 57 Abb., [Hartleben Verlag] Wien
/ Pest / Leipzig.
STIEFEL, H. C. (1894): Das Raffiniren des Weinsteines und die
Darstellung der Weinsteinsäure. Mit Angabe der Prüfungsmethoden der
Rohweinsteine auf ihren Handelswerth. Für Grossindustrielle sowie
für Weinbauer.- Chemisch-technische Bibliothek, CCXIV. Band, 96 S.,
8 Abb., [Hartleben's Verlag] Wien / Pest / Leipzig.
TEGETHOFF, F. W. [Hrsg.] (2001): Calciumcarbonat Von der
Kreidezeit ins 21. Jahrhundert.- 342 S., sehr viele, meist farb.
Abb., Tab., Zeichnungen und Tab., [Birkhäuser Verlag] Basel.


Der Weinstein bildet an Korken wunderschöne, funkelnde und
spiegelende Kristalle, hier an einem Elbling von der Mosel,
Bildbreite links 2 cm, rechts 5 mm.
*Die Tagung des Oberrheinischen Geologischen Vereins e. V. fand 1978
in Bad Orb statt. Ich nahm als Schüler am 31.03.1978 an der
Exkursionen C in den Spessart teil und man fuhr damals auch zum
Restaurant Käfernberg in Hörstein (Alzenau). Hier wurde im
"Käfernberg" der örtliche Wein verkostet, der bekanntermaßen auf den
Kristallingesteine des Spessarts wächst. Nach etlichen Gläsern
wurden von den bereits betagten Geologen die Haupt- und
Spurenbestandteile des Gesteins aus dem Geschmack des Weins (heute
als Terroir umschrieben) geschlossen ...
Dazu schaue man in das umfangreiche Werk von DECROUEZ et al. (2018).
Das ist wohl das umfangreichste, was man zum Weingeschmack leicht
verständlich publiziert hat. Es ist zwar für die Schweiz
geschrieben, passt aber in weiten Teilen auch auf andere
Weinanbaugebiete, da die schweizer Gesteine nicht wesentlich anders
sind als die in Deutschland. Es eine höchst interessante Verquickung
von Weinbaukunde und Geologie. Es ist ein Lesegenuss, so dass man
sich gerne und neugierig durch die Kapitel hangelt. Und das
monumentale Werk ist vom gefälligen Layout, der Herstellung und dem
stabilen Schuber etwas ganz besonderes für den Bücherschrank oder
die Bibliothek.
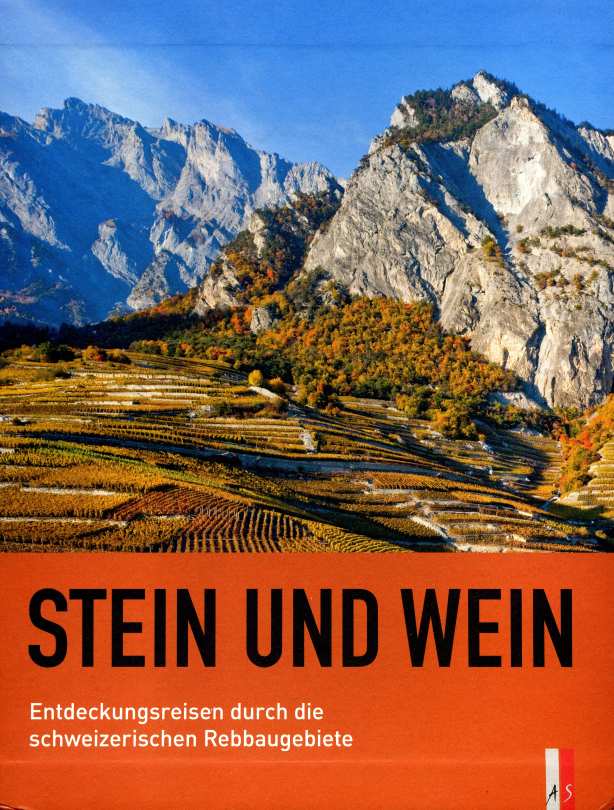
Es kostet 99 Schweizer Franken.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite