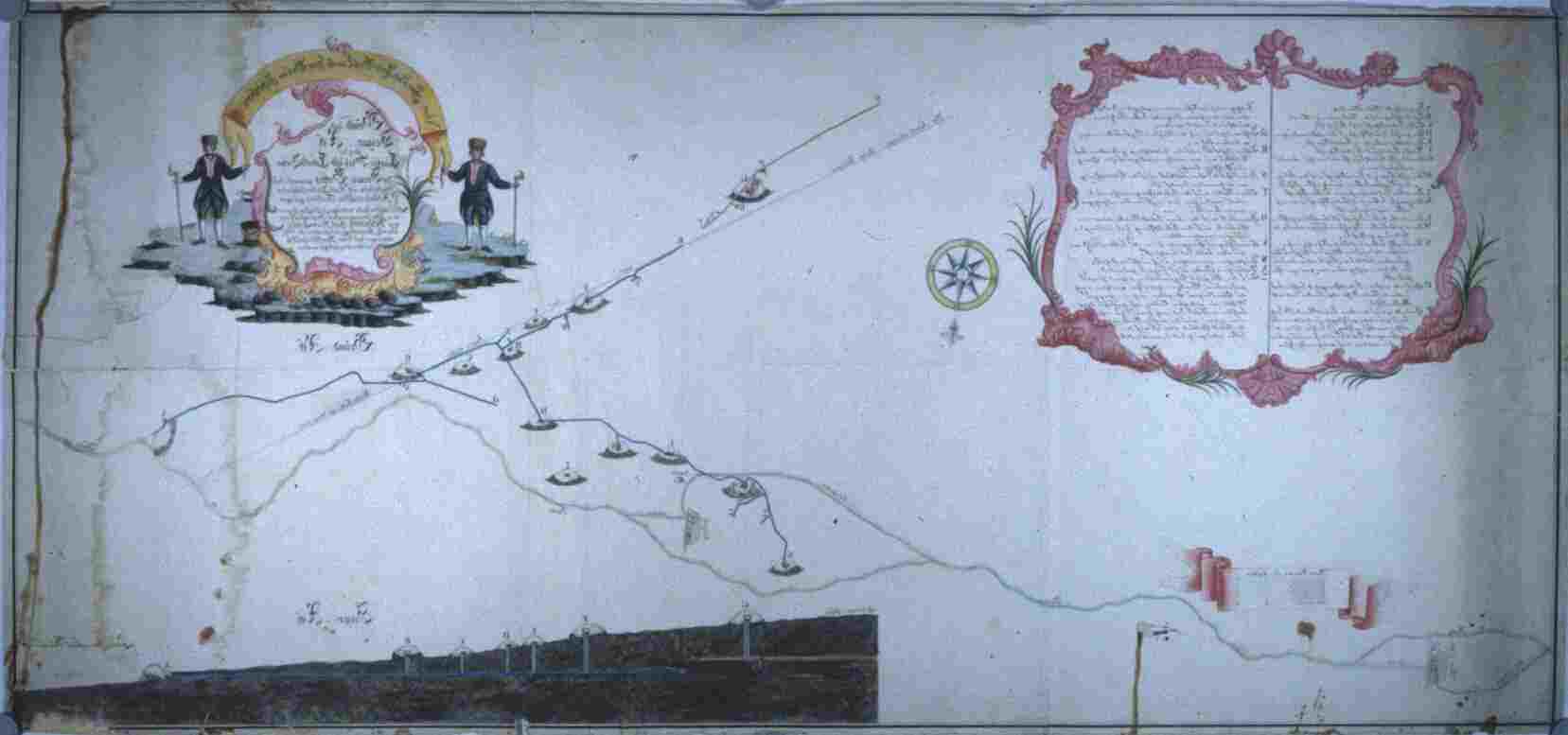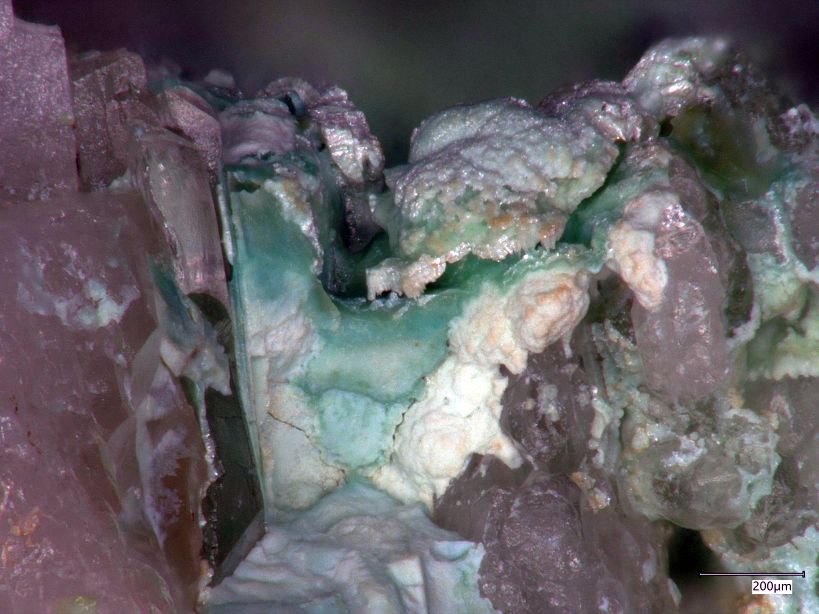Die bunten Mineralien der
Grube „Segen Gottes“
bei Huckelheim
im Spessart
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main
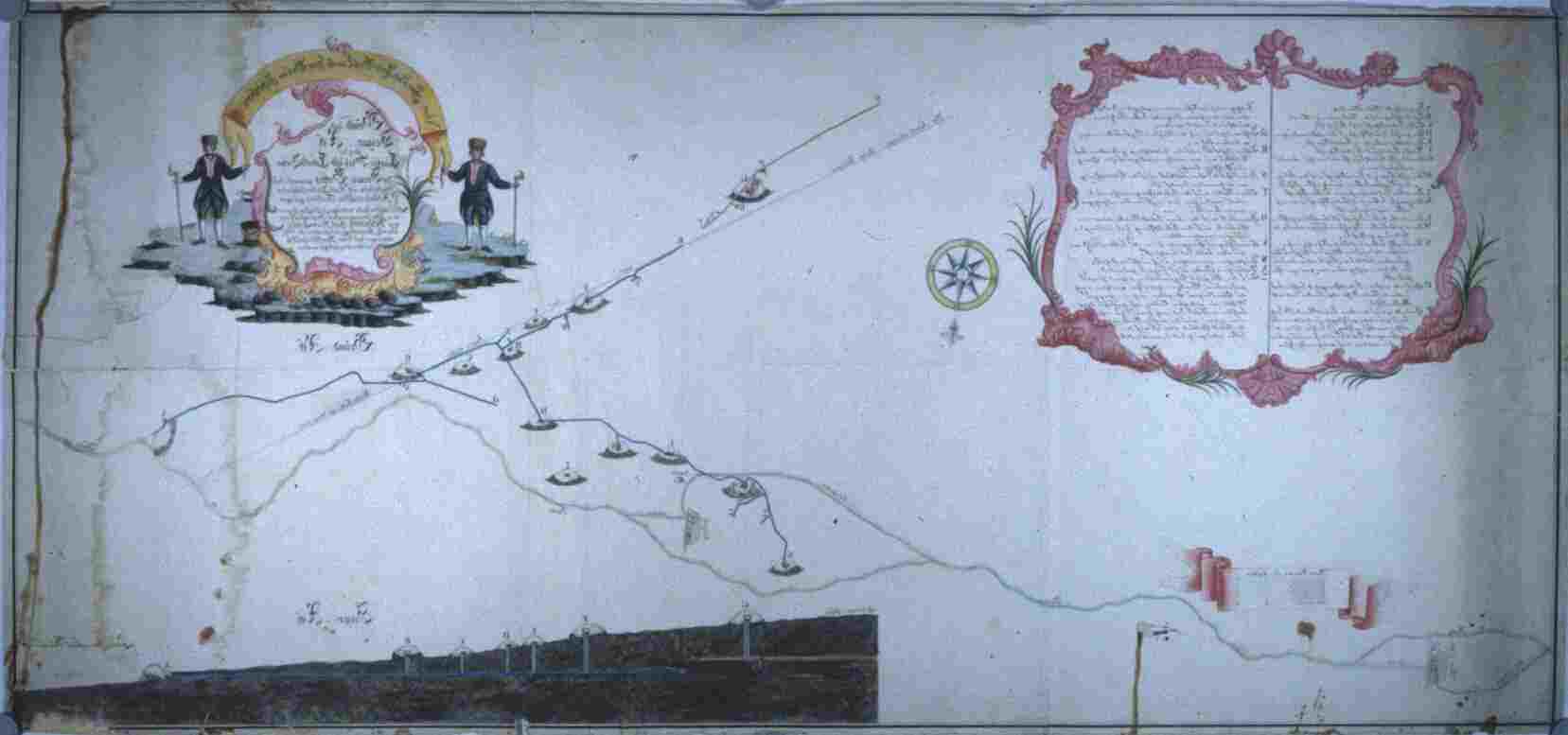
Großformatiger, colorierter Grund- und
Saigerriss des Bergwerkes Segen Gottes aus dem Jahr 1782
(angefertigt von Johann Heinrich Karl SCHÖNAUER wegen
Streitigkeiten),
Original im Staatsarchiv in Würzburg (157 x 73 cm; Bestand
Schönborn).
(das Foto wurde von Thomas WEIS, Schneppenbach, zur Verfügung
gestellt).
 Die Ortslage von Huckelheim im Herbst als
Panoramafoto man erkennt im Talgrund den Ort und im
Hintergrund und links die bewaldeten Höhen des Buntsandsteins;
Die Ortslage von Huckelheim im Herbst als
Panoramafoto man erkennt im Talgrund den Ort und im
Hintergrund und links die bewaldeten Höhen des Buntsandsteins;
aufgenommen am 17.06.2006.
Lage:
Im nördlichen kristallinen Vorspessart finden sich neben Bieber
weitere Buntmetallvererzungen im Kupferschiefer. Die Grube „Segen
Gottes“ bei Huckelheim liegt auf der TK 5821 Bieber bei R 1800 H
5480 (siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 288, Aufschluss 271). Die nur
in geringen Mengen vorhandenen Halden des ehemaligen Bergbaues
(Grube "Segen Gottes") bei Huckelheim liegen (E) zwischen dem
Aelchen (Bachgrund des Querbaches) und der Ziegelhütte.
Die Halden sind bewaldet und wurden in den letzten Jahren (ca.
1984 - 88) von Sammlern "heimgesucht". Fundmöglichkeiten bestehen
auf den außerhalb des Waldes liegenden Äckern, aber ausschließlich
außerhalb der Vegetationsperioden ohne einen Flurschaden
anzurichten. Nun sind fast alle früheren Äcker in Wiesen
umgewandelt worden, so dass es kaum noch Möglichkeiten gibt, auch
nur an Belegstücke zu kommen. Dieses Vorkommen wurde über Jahre
von Thomas WEISS, Schneppenbach unter Mithilfe von R. T. SCHMITT,
Würzburg besammelt und die Funde bestimmt.
Bergbauhistorie:
Die ersten urkundlichen Erwähnungen bergbaulicher Aktivitäten
(sicher Kupferschieferbergbau) in der Region sind aus den Jahren
1454, 1468 und 1479 bekannt; ob bergbauliche Aktivitäten
erfolgten, ist indes nicht sicher. Seit 1666 gehört das Gebiet von
Huckelheim zu den Grafen von SCHÖNBORN. 1719/20 betrieben die
Freiherren von GROSCHLAG aus Dieburg ein Bergwerk in Huckelheim.
1759 wurde der Bergbau auf Kupfer, Blei und Kobalt von den
SCHÖNBORNs wieder aufgenommen. Der Abbau erfolgte im Aehlchen
östlich von Huckelheim. Aus dem Jahr 1771 ist berichtet, dass er
hier neben dem Bergwerk auch eine Schmelze gibt, dessen Schlacken
über lange Zeit der Quell für Mineraliensammler waren.

Typische Schlackenstücke als Folge des Probierens
und der vermutlichen Smalteproduktion;
Bildbreite ca. 15 cm.
Neben den Kupferletten wurde auch ein hydrothermaler Gangbergbau
auf Kobalterze betrieben. Aus dem Kupferschiefer gewann man neben
dem Kupfer auch geringe Mengen an Silber. Von 1782 ist ein schöner
Grund- und Saigerriß erhalten. Der 30jährige Rechtsstreit zwischen
den Schönborn und Kurmainz endete 1789 (in Wien entschieden!) mit
dem Schließen der Gruben, da die schwermetallhaltigen Abgänge aus
den Pochwerken die Fischgewässer verunreinigten (ein früher
Umweltprozess mit einem großen Aktenberg; wie in Bieber). Ob aus
den Kobalterzen Smalte gewonnen wurde, ist nicht überliefert.
In späterer Zeit wurden mehrfach neue Prospektionen durchgeführt,
die aber nie mehr zu einem Kobalt-Bergbau geführt haben.
Es besteht heute kein Zugang mehr zu den untertägigen Anlagen.
Leider wurden auch die obertägigen Zeugen des Bergbaues von der
Flurbereinigung in den 70er Jahren nahezu völlig getilgt.
Merkwürdigerweise sind sammlerische Belegstücke in
den alten (öffentlichen) Sammlungen äußerst selten bzw. nicht
vorhanden. Auf dem Mineralienmarkt werden auch keine Stücke aus
der Bergbauzeit gehandelt. Aus diesem Grund war es mir bis heute
nicht möglich, ein Erzstück mit Kobalterzen (z. B. Skutterudit
wie in Bieber) zu untersuchen. Der Grund könnte sein, dass der
Bergbau zu einer Zeit erfolgte, in der keine Belegstücke
gesammelt worden sind. Und die wenigen Belegstücke aus dem 18.
und 19. Jahrhundert haben die Zeiten und Wirrnisse, besonders
der 2. Weltkrieg, nicht überlebt.
Geologie:
Über dem Grundgebirge (besteht aus den Gesteinen der
Mömbris-Formation) ist um Huckelheim das Rotliegende und die
Sedimente des Zechstein sehr mächtig abgelagert. Über dem
Zechsteinkonglomerat findet sich hier der Kupferschiefer (wegen
der tonigen Ausbildung als Kupferletten bezeichnet). Dieser ist
der Erzträger mit den Phasen Tennantit (Träger des Silbers),
Galenit, Chalkopyrit, Arsenopyrit und selten weitere Erze. Daneben
ist Dolomit und Baryt in den Drusenräumen weit verbreitet.

Bruchrauer Kupferschiefer mit rundlichen
Dolomit-Drusenfüllungen und Tennantit
(unten rechts);
Bildbreite ca. 3,5 cm.
Daneben ist hier eine Gangvererzung mit einer Sprunghöhe von 8 m
erschürft worden. Der mit ca. 80° einfallende, NE streichenden und
bis zu 1 m mächtige Gang bestand aus Baryt mit Skutterudit,
Tennantit, Chalkopyrit und in geringem Umfang auch Bismuterze.

Goldgelber, rissiger Chalkopyrit als angewitterter
Haldenfund;
Bildbreite ca. 1,5 cm.
Belegstücke lassen sich ausschließlich auf den Feldern sehr
mühevoll und stark verwittert aufsammeln. Die
Aufschlussverhältnisse sind als sehr schlecht zu bezeichnen.
Mineralogie:
Die Mineralisation ähnelt sehr der aus Bieber, die ja nur wenige
km Luftlinie entfernt liegt. Im Unterschied zu Bieber fehlt hier
jedoch jeglicher Muskovit oder Stücke aus metamorphen Gesteinen
bzw. Quarz. Stücke aus dem Zechstein sind jedoch kaum zu
unterscheiden.
Folgende Mineralien wurden (meist nur als winzige Kristalle oder
nur erzmikroskopisch) nachgewiesen:

Blauer Azurit und grüner Malachit auf weißem
Baryt;
Bildbreite ca. 2 cm.
- Brochantit
- Baryt
- Beryerit
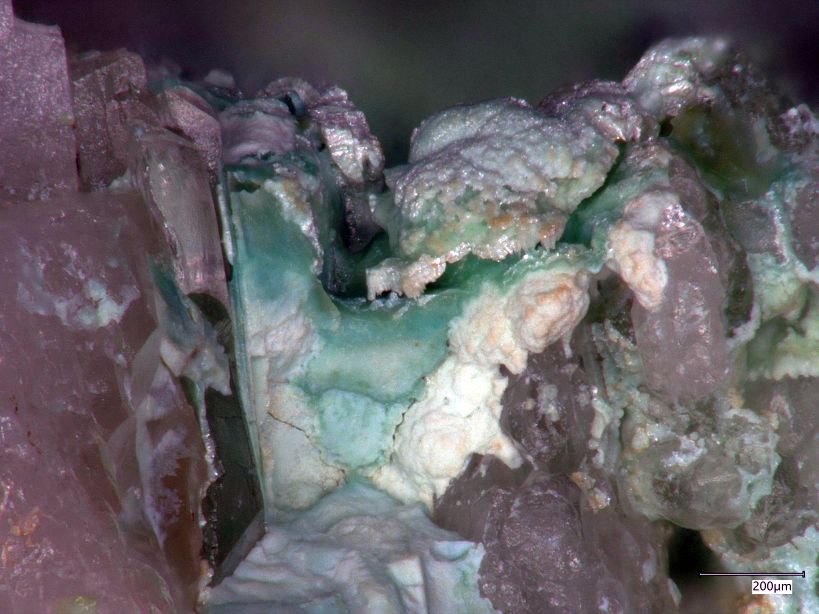
Grünweißer Beyerit als Zwickelfüllung zwischen
Baryt-Kristallen;
Bildbreite 1,5 mm
- Cerrusit
- Chalcanthit
- Calcit
- Chalkopyrit:

Verwachsung von derbem Chalkopyrit (goldgelb) mit
Pyrit (weißgelb), dunkle Flecken
sind Goethit; (angeschliffen und poliert);
Bildbreite ca. 9 cm.
- Chrysokoll
- Covellin
- Cuprit
- Duftit
- Dolomit
- Emplektit
- Enargit
- Erythrin
- Galenit
- Gips
- Goethit

Glaskopfartiger bis erdiger Goethit mit
eingewachsenen Baryt-Klasten und etwas
Lepidokrokit als idiomorphe Kristalle auf dem Geothit, (gefunden
um 1990 von
Hermann URNER, damals Bessenbach);
Bildbreite 8 cm.
- Hämatit
- Kryptomelan
- Lepidokrokit
- Löllingit
- Malachit
- Mimetesit

Radialstrahlige Mimetesit-Kristalle auf
Dolomit,
Bildbreite 2 mm
- Markasit
- Olivenit
- Pharmakosiderit
- Pyrit
- Quarz
- Rhodochrosit
- Richelsdorfit
- Romanèchit

Romanechit (schwarz) mit Goethit (braun) und
brekziösem Baryt (weiß),
Bildbreite ca. 2,5 cm
- Siderit
- Skutterudit
- Sphalerit
- Spionkopit
- Tennantit
- Tirolit
- Yarrowit
Literatur:
AMRHEIN, A. (1896): Der Bergbau im Spessart unter der Regierung
der Kurfürsten von Mainz.- Archiv des historischen Vereins, Bd. 37,
S. 24ff, [Stahel´sche Buchhandlung] Würzburg.
FREYMANN, K. (1991): Der Metallerzbergbau im Spessart. Ein Beitrag
zur Montangeschichte des Spessarts.- Veröffentlichung des
Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 33, 413 S.,
Aschaffenburg. FRIEDRICH, G., DIEDEL, R., SCHMIDT, F. P. &
SCHUMACHER, C. (1984): Untersuchungen an Cu-As-Sulfiden und
Arseniden des basalen Zechsteins der Gebiete Spessart/Rhön und
Richelsdorf.- Fortschritte Mineralogie 41, Beiheft 1, S.
63 - 65.
HOCK, J. & WEISS, T. (1992): Ehemalige Grube "Segen Gottes"
bei Huckelheim eine Fundstelle im Zechstein des Spessarts.-
Aufschluss 43, S. 55 - 63, Heidelberg.
LOIBL, W. (2002): Brunnen- und Bergwerke. Kurmainzische
Rahmenbedingungen für Grünewalds Aufenthalt in Aschaffenburg.-
Spessart 96, Heft November 2002, S. 4 - 21, 14 Abb.,
[Main-Echo GmbH & Co KG] Aschaffenburg.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.
HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche
Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 622, 727, 566,
732, 719, 153.
LORENZ, J. (2016): Der Kupferschiefer im Spessart.- NOBLE Magazin
Aschaffenburg, Ausgabe 03/2016, S. 64 - 66, 6 Abb.,
[Media-Line@Service] Aschaffenburg.
MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung
Geologischer Führer Band 44, S. 143, Berlin.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und
Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer
Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils
farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)
[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.
RÜCKER, E. (1985): Ein Plan von der Kupfer-, Blei- und Kobaltzeche
Segen Gottes bei Huckelheim.- Unser Kahlgrund Heimatjahrbuch 30,
S. 100 - 107, Alzenau.
PRÜFERT, J. (1969): Der Zechstein im Gebiet des Vorspessarts und
der Wetterau.- Sonderveröffentlichung d. Geologischen Inst. d.
Univ. zu Köln, Heft 16, 176 + X Seiten, Bonn.
SCHMITT, R. T. (1991): Buntmetallmineralisation im Zechstein 1
(Werra-Folge) des nordwestlichen Vorspessarts
(Großkahl-Huckelheim-Altenmittlau).- Diplomarbeit am Institut f.
Mineralogie der Uni. Würzburg, 228 S., Würzburg
[unveröffentlicht].
SCHMITT, R. T. (1993): Sulfide und Arsenide aus den Gruben Segen
Gottes bei Huckelheim und Hilfe Gottes bei Großkahl im Spessart.-
Aufschluss 44, S. 111 - 122, Heidelberg.
SCHMITT, R. T. (1993): Richelsdorfit aus dem Spessart.- Lapis 18,
Nr. 11 November 1993, S. 33, München.
SCHMITT, R. T. (2001): Zur Petrographie, Geochemie und
Buntmetallmineralisation des Zechstein 1 (Werra-Folge) im Gebiet
Huckelheim - Großkahl (Nordwestlicher Spessart).- Mitteilungen des
Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Bd. 20,
100 S., 42 Abb. (davon 5 farbig), 23 Tab., Hrsg. vom
Naturwissenschaftlichen Verein Aschaffenburg.
Zurück zur Homepage
oder zum Anfang der Seite