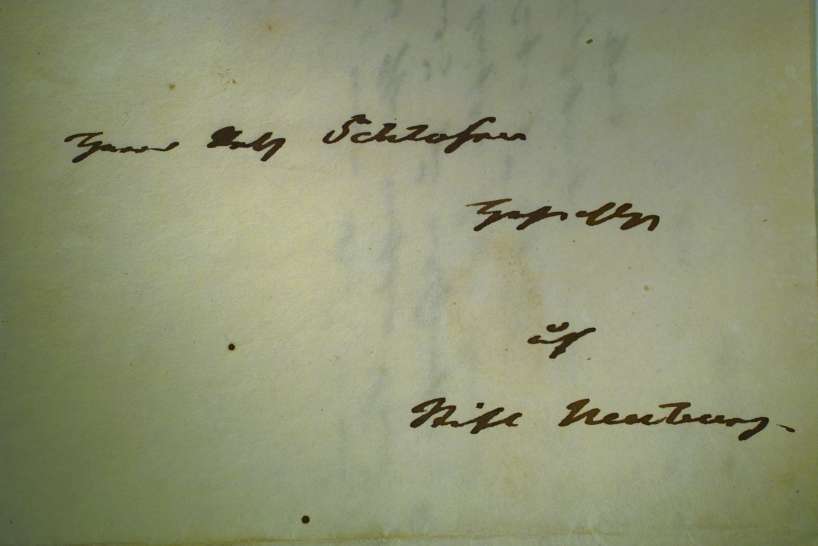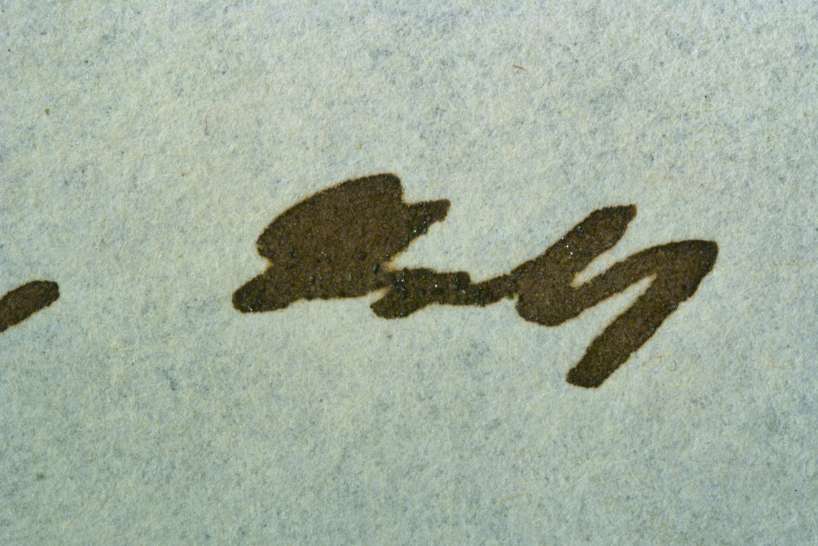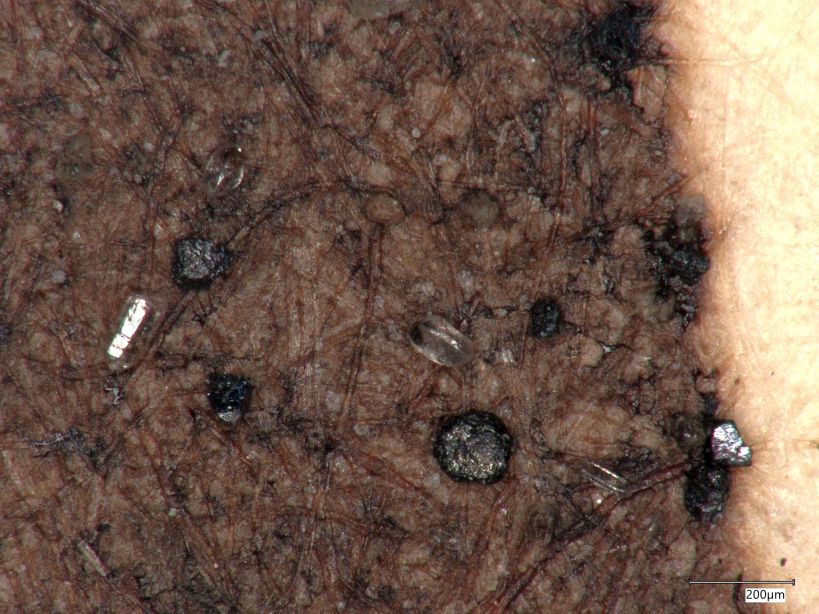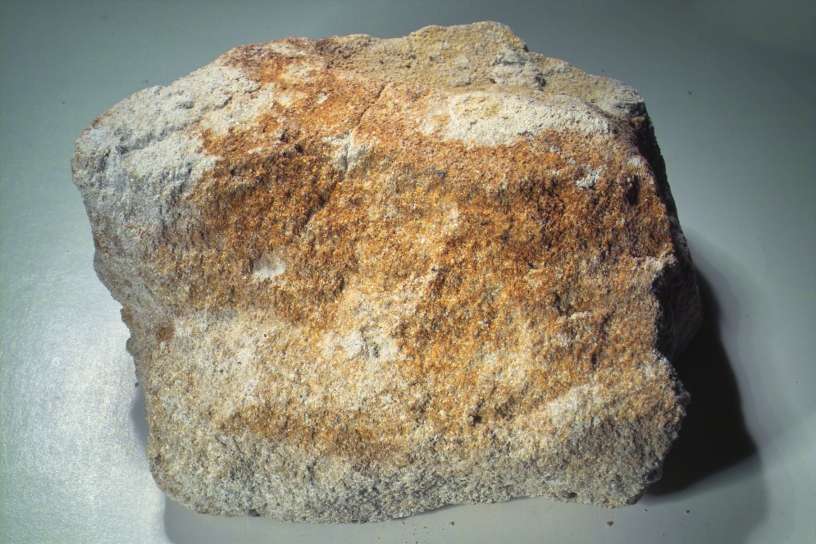Streusand,
Löschsand, Schreibsand, Reibsand.
aus der Zeit, als man mit Tinte und Federn schrieb und es
kein Löschpapier gab.
von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Schreibset aus Steingut aus dem 19. Jahrhundert. Links das
Tintenfass (mit
modernen Schreibgeräten), in der Mitte die Löcher für die Federn
und rechts
bzw. davor liegend die Streusandbüchse, einst mit Löschsand
gefüllt.
Sammlung P. SCHNERCH, Aschaffenburg,
Bildbreite etwa 25 cm.
Streusand*, Löschsand**, Schreibsand!
Alte Briefe können eine Besonderheit aufweisen. In den
breiten und dunklen Teilen der Schrift aus Tinte sind unter dem
Mikroskop bis zu 0,2 mm große Sandkörnchen zu erkennen. Dieser
feine Sand besteht aus gut gerundeten Quarz-Körnchen und kleine
Blättchen aus Muskovit, so dass man als Liefergebiete des Sandes
ein Kristallingebiet erschließen kann (oder auch aus dem
Buntsandstein, denn der führt neben Quarz auch Glimmerblättchen
wie z. B. Muskovit). Diese Bestandteile der Schrift stammen vom
Löschsand (auch als Streusand oder Schreibsand bezeichnet), den
LEONHARD verwandte, um die überschüssige Tinte zu binden; damals
gab es noch kein Löschpapier. Das ist sicher ein wenig
beachteter Echtheitsbeweis, denn so was verwendet heute niemand
mehr.

Sandfass eines Schreibsets aus weißem Porzellan, oben
glasiert und ohne
Möglichkeit des Zerlegens, d. h. der Löschsand musste über die
Löcher
auf der Oberseite eingefüllt werden. Vermutlich frühes 19.
Jahrhundert,
Bildbreite 8 cm
Ein Schreibzeug aus der Zeit beinhaltete neben dem
Tintenfass auch noch eine Streusandbüchse (Sandfass). Diese
kleinen Gefäße bestanden aus Holz, Porzellan oder Metall mit
einem Sieb (ähnlich einem heutigen Salzstreuer), aus der
Streusand aufgetragen wurden. Der überschüssige Streusand wurde
dann beim Falten wieder erfasst und zurück in das Gefäß
gebracht. Der in der Tinte fixierte Sand war verloren und ging
mit auf die Reise.
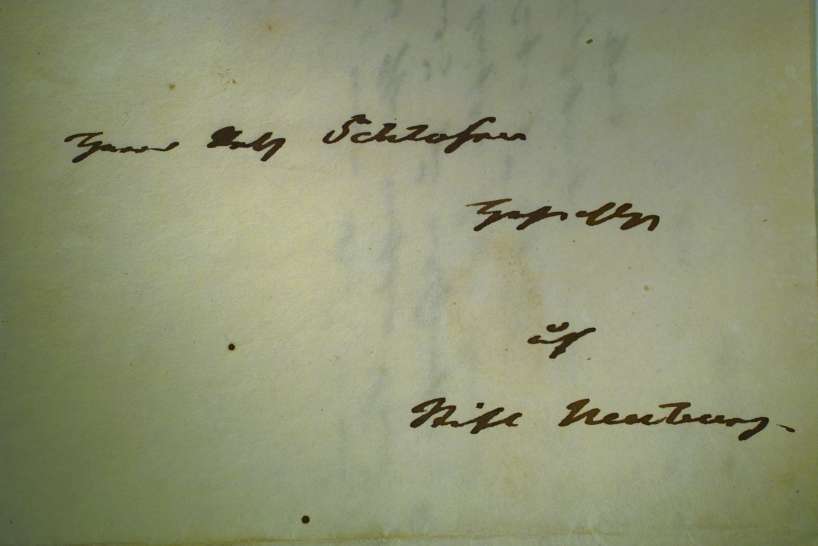
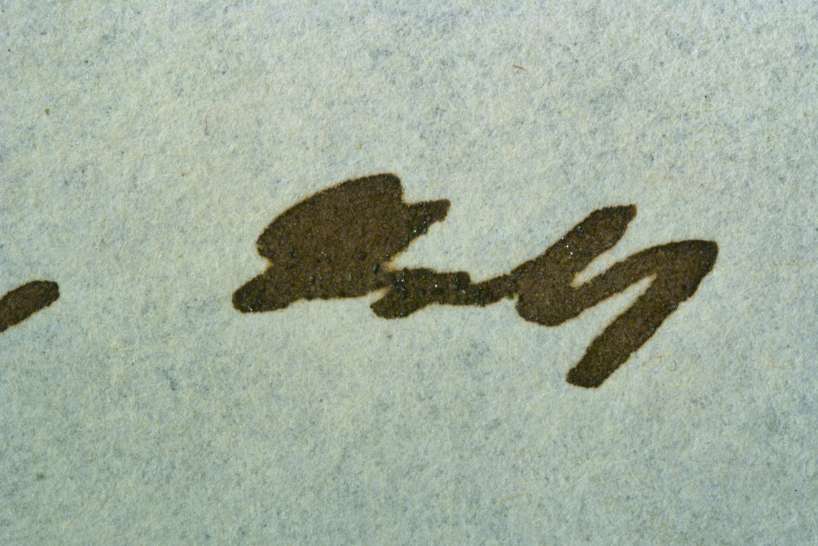

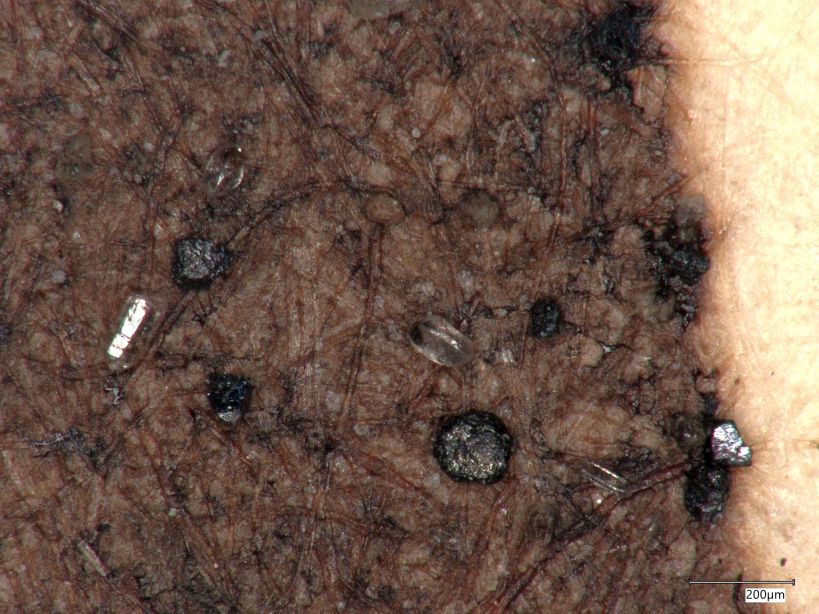
Löschsand, mit Tinte fixiert, auf einem Brief vom Heidelberger
Mineralogen Karl Caesar Ritter von
LEONHARD aus dem Jahr 1840 an Johann Friedrich
Heinrich SCHLOSSER (*1780 †1851, war Privatgelehrter, hatte das
Stift am Neckar bei Heidelberg im Zuge der Säkularisation 1825
gekauft und zu einem
Treffpunkt für Literaten, Musiker und Kunstfreunde ausgebaut) auf
Stift Neuburg bei Heidelberg.
In dem Ausschnitt (unten) sind die bis zu 0,2 mm großen
Sandkörnchen auf dem Papier mit der Tinte gut erkennbar. Man kann
sogar Quarz, Magnetit
und wahrscheinlich Apatit (glänzender Stängel links)
identifizieren.
Bildbreiten (oben links) 12 cm, (oben rechts) 2 cm, (unten links)
7 mm und (unten rechts) 1,5 mm.
Der obige Brief stammt aus einer Zeit, in der es im Raum
Heidelberg noch keine Briefmarken gab, sondern der Empänger
musste das Porto bei der Übergabe bezahlen. Briefe wurden
versiegelt und bestanden in der Regel aus einem Papierbogen, der
so gefaltet wurde, so dass die Adresse außen und der Inhalt für
den Überbringer nicht sichtbar innen stand.
Wie in anderen Technologien auch, waren die Römer
der Zeit weit voraus. Sie schrieben mit der Feder (Vogelfeder),
aber auch mit Federn aus Bronze, wie man von Funden am Limes
weiß. So bildet GRAICHEN (2009:27) eine Schreibfeder aus Bronze
neben einem kunstvoll verzierten Tintenfass ab, die denen des
19. Jahrhunderts sehr ähnlich sind. Der Fund stammt aus dem
vicus in Koblenz. Und man schrieb mit Tinte auf Holztäfelchen,
die aber nur ganz selten erhalten geblieben sind, wie z. B. in
Vindolanda am Hadrianswall in Schottland (GRAICHEN 2009:61ff).
Wohl das ganze Mittelalter schrieb mit Vogelfedern (die mit
einem scharfen Federmesser nachgeschnitten werden mussten), bis
in der Mitte des 18. Jahrhundert in Aachen die Schreibfeder aus
(Feder-)Stahl wieder erfand. Aber erst ab der Mitte den 19.
Jahrhunderts wurde mit der Massenproduktion von Schreibfedern
aus Stahl in England dieVogelfeder verbreitet abgelöst.
Nach LENZEN (2022:154) wurde noch 1938 eine ganze
Schiffladung Löschsand aus Dueodde auf der Ostseeinsel Bornholm
zu der Weltausstellung nach London verfrachtet. Der Sand ist ein
Glaukonit-reicher Grünsand aus der Obekreide mit einer
gleichmäßigen Körnung und großer Feinheit, so dass die Tinte
schnell adsorbiert werden kann.
Dann wurde diese vom Füllfederhalter verrängt und in den
1970er Jahren wurden diese mit Tintenpatronen ausgerüstet. Aber
dies war immer mit dem ungewollten Ausfluss von Tinte begleitet.
Der immer scheibende und auslaufsichere Kugelschreiber
verdrängte ab den 1980er Jahren die Tinte. Hochwertige
Schreibgeräte (z. B. Füllfederhalter deren Feder an Spitze aus
dem sehr harten Platinmetall Iridium bestehen) mit Tinte werden
nur noch ausnahmweise verwandt.
Über eine Gewinnung von Streusand im Spessart schreibt bereits
der bekannte Forstmann Stephan BEHLEN (BEHLEN 1823a:28):
[Magneteisenstein, Magnetit Fe3O4]
"... in den Schluchten der Gebirge [er meint damit den
Spessart] und zwar in solcher Menge sammelt, daß nach starkem
Regen oder nach dem Schmelzen des Schnees dieselbe ganz schwarz
erscheinen, und von armen Leuten gesammelt, rein gewaschen, und
als Streusand verkauft wird."
Hinweis:
Das geht heute nicht mehr, da nahezu aller Boden im kristallinen
Vorspessart (nur hier gibt es nennenswerte Mengen von Eisenoxiden
wie Hämatit und Magnetit) von Pflanzen bewachsen ist; nicht
begrünte Flächen gelten als "unnatürlich". Die Wege und Straßen
sind mit fremdem Material befestigt oder gar asphaltiert und die
Rinnsale, Bäche und Abflussmöglichkeiten für Regenwasser an den
Wegen und Straßen erosionsmindernd ausgeführt. Aber zu Zeiten von
BEHLEN war der Spessart viel weniger bewaldet und selbst dort
wurde das Laub zusammen gefegt und als Einstreu verwandt, so dass
es große, vegetationslose Flächen gab, von denen Feinmaterial beim
Regen abgespült werden konnte. In der Fläche waren alle
landwirtschaftlich bearbeitbaren Flächen in Nutzung, so dass es
auch hier im Winter zu Abspülungen kam, die man dann wie oben
beschrieben nutzte.
Der Streusand aus Eisenoxiden ist schwarz, so dass die
Körnchen in der Tinte nicht auffallen, auch wenn sie nur wenig
von der Tinte benetzt wurden. Deshalb eigenen sich dunkle Sande
besser als helle Sande.


So muss man sich den BEHLEN´schen Streusand
(Magnetit-Sand) vorstellen: Gewaschener und noch nicht
gesiebter
Schwermineralsand, überwiegend aus Magnetit, aber auch aus
Hämatit und Ilmenit, dazu noch einige Zirkone, bestehend
(als Schwersand aus den Mainsedimenten),
Bildbreite 6 cm, im Detail 3,3 mm.
Solcher Löschsand aus Eisenoxiden wie Magnetit wurde auch
bis ins späte 19. Jahrhundert als Nebenprodukt beim Goldwaschen
am Rhein mit gewonnen und verkauft. Dies brachte den
Goldwäschern eine erhebliche Nebeneinnahme ein (LEPPER 1980:45).
Auch aus Kleinostheim ist bekannt, dass man dort Streu- und
Scheuersand gewann und diesen bis nach dem 2. Weltkrieg auf dem
Markt in Aschaffenburg verkaufte (LORENZ 2010:536f, 688f). Dabei
erfolgte die Sandgewinnung aus einer kleinen Scholle des Unteren
Buntsandsteins, die an der Spessartrandverwerfung versenkt und
zwischen dem Klüften alteriert, und nicht erodiert wurde. Dabei
ist der Feldspat-Anteil im Sandstein zum weißen Tonmineral
Kaolinit umgesetzt worden, so dass der Sandstein rein weiß
erscheint und keine große Festigkeit mehr aufweist. So kann man
ihn leicht zu einem weißen Sand zerreiben. Solche weißen
Sandsteine sind im Spessart stellenweise vorhanden und abgebaut
worden in Waldaschaff, Eichenberg, ... In den anderen Vorkommen
ist die Ursache der Zersetzung im feucht-warmen Klima des
Tertiärs zu suchen.
Hier in Kleinostheim ist wahrscheinlich eine hydrothermale
Veränderung wahrscheinlich, da ja dieses Vorkommen Teil der N-S
verlaufenden Spessartrandverwerfung ist. Über diese Spalten
konnten Wässer in den Sandstein eindringen und die Feldspäte in
Tonmineralien zersetzen und das einst färbende Eisen abführen,
was sowohl den Festigkeitsverlust als auch die weiße Farbe
verursachte.

Tonreicher Reibsand, der auch als Streu- und Löschsand
verwendet
werden konnte, aus dem Vorkommen in Kleinostheim, getrocknet
und gesiebt,
Bildbreite 8 cm
Durch den über lange Zeit fort gesetzten Abbau in
Kleinostheim entstand eine steinbruchähnliche Grube (im lokalen
Volksmund "Reibsandkaute"), die heute mit Wald bestanden ist und
so kaum auffällt. Infolge der geringen Beständigkeit sind keine
Felsen zu sehen. Der Kulturweg "Kleinostheim 10 Jahre länger
leben" erinnert mit einer kleinen Tafel an das Vorkommen nahe
des Schluchthofes nördlich von Kleinostheim am Eingang zur
Rückersbacher Schlucht.
Das Wort "Reibsand" meint den Sand, den man zum Reinigen der
hölzernen Dielenfußböden verwandte. Dabei scheuerte man
einerseits unerwünsche Farben am Boden durch die Quarzkörner
weg, andererseits wurde in das aufgerauhte Holz der weiße Ton
gerieben, so dass die Dielen dann "sauber" aussahen. Der
überschüssige Sand wurde abgekehrt und kam auf den Abfall (in
der Regel der Misthaufen) vor dem Haus.

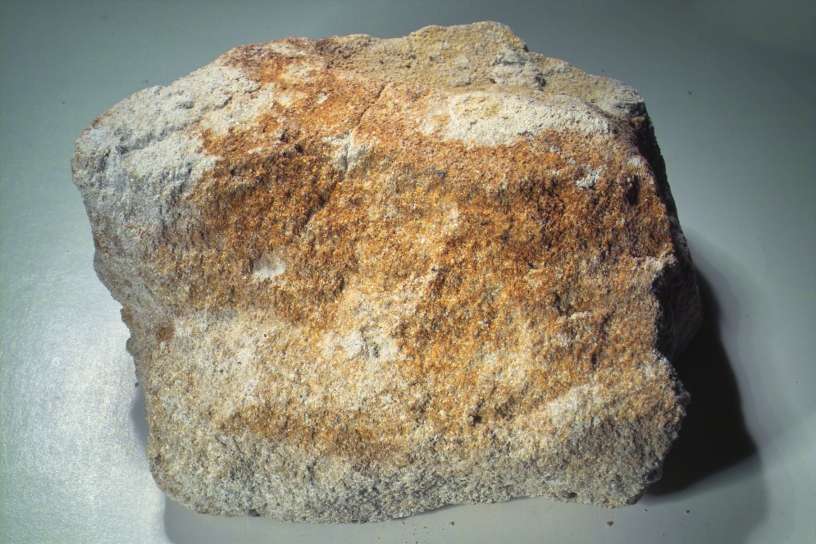
Reibsandkaute bei Kleinostheim: Unter einer Wurzel steht der
Sandstein an. Infolge der schlechten Lichtverhältnisse erscheint
der Sandstein nicht weiß;
aufgenommen am 01.04.2006.
Stück weißer, bröseliger Sandstein mit etwas braunen
Eisenhydroxiden auf einer Kluft aus dem Vorkommen, der nach dem
Zermahlen zum Reib-, Streu- und Löschsand verarbeitet wurde;
Bilbreite 13 cm.

Blick von Osten nach Westen in den Abbau der einstigen
Reibsandkaute von Kleinostheim im Winter, da im Sommer mit der
Belaubung der Bäume kaum
etwas zu sehen ist;
Panoramafoto aufgenommen am 27.01.2019.

Gebleichter und verwitterter Sandstein als Teil eines
Wurzeltellers eines
umgefallenen Baums. Der hier zu gewinnende feinkörnig, weiße (weil
tonreiche) Sand eignet sich hervorragend als Streu- oder
Löschsand.
Er kann von Hand zu einem weißen Pulver zerdrückt werden;
aufgenommen am 27.01.2019.
Und wohin ist das Eisen verschwunden, was den
Sandstein einst färbte? Verdunsten kann es nicht. Nun, es
migrierte in die Sedimente der Umgebung, so dass man neben den
verkieselten Konglomeraten (Tertiär-Quarzite, siehe LORENZ
2019:27) auch solche findet, bei denen der Zement aus einem
eisenhaltigen Manganoxid (Ferro-Hollandit?) besteht.


Links: Moosüberwachsenes Konglomerat aus weißen Quarzen, mit einem
Manganoxid als Zement; Bildbreite etwa 45 cm;
aufgenommen am 23.09.2023.
Rechts: Mikroskopisches Foto eines Bruchstückes des Zements aus hier
fast farblosen Quarzen und dem grau erscheinenden
Manganoxid;
Bildbreite 1,5 mm.
* Mit Streusand könnte man auch noch einen Sand meinen, der
bei Schnee und Eis als abstumpfendes Mittel auf Gewege und
Straßen aufgetragen wird. Dieser wurde inzwischen vom Tausalz
aus Kochsalz (NaCl) weitgehend abgelöst, da man Sand wieder
aufkehren muss oder den Sand in der Kanalisation wieder
findet.
** Es gibt noch einen Löschsand, den man mit dem Löschen von
Feuer in Verbindung bringen kann, denn manche Brände lassen sich
nicht mit Wasser löschen. So z. B. Metalle wie Magnesium, die
man auch mit einer größeren Menge (Quarz-)Sand löschen kann.
Oder die Brandbomben in den deutschen Städten mit Phosphor,
Elektron und Thermit wärend des 2. Weltkrieges.
Aber auch der sehr feine (Quarz-)Sand in den Schmelzsicherungen
aus weißer Keramik der elektrischen Stromkreise dient zum
Löschen den Lichtbogens bei einem Durchbrennen (auch als
"Herausfliegen" bezeichnet). Da kaum mehr solche Sicherungen
verbaut werden, gibt es solche Sicherungen nur noch in älteren
Anlagen.
Eichenberg (Sailauf)

Im Steinbruch an der Kuppe bei Eichenberg wurde ein weißer Sandstein
abgebaut;
aufgenommen am 18.02.2021.
In den oberflächennahen Teilen des Steinbruchs an
der Kuppe bei Eichenberg ließ sich auch leicht ein weißer Sand
gewinnen, den man als Scheuersand verwandte (OKRUSCH et al.
2011:223).
Wenigumstadt (Großostheim)

Der "Linsenbuckel" (heute Rittelberg) mit der Hinweistafel auf den
weißen Sand bei Wenigumstadt; links der Bildmitte am Horizont ragt
der Wartturm auf, zwischen Schaafheim und Wenigumstadt gelegen;
aufgenommen am 05.04.2023.
Ein weiterer Ort, in dem ein weißer Scheuersand gewonnen
wurde, ist Wenigumstadt. Hier berichten Heimatforscher,
dass Valentin VOLK in der Flur "Linsenbuckel" (Rittelberg)
nördlich des Ortes bis ins frühe 20. Jahrhundert weißen Sand zum
Scheuern der Dielen gewonnen hat ("Wilschenimschder
Scheuermittel"). Die Gewinnung in einem "tiefen Stollen" ist
vermutlich ein sprachliches Missverständnis, denn an der
bezeichneten Stelle gab es sicher keinen Stollen, denn der hätte
in dem nicht standfesten Gestein einen aufwändigen Verbau
erforderlich gemacht; wahrscheinlich handelte es sich um eine
"tiefe" Grube. Heute sind keine Reste mehr erkennbar, da hier
eine Flurbereinigung stattfand.
Mit der Grube wurde unter dem Löss der entfärbte Buntsandstein
erschlossen, in geringen Mengen abgebaut und anschließend
körbchenweise verkauft wurde. Wie auf der Tafel beschrieben
(wörtlicher Text aus dem Buch: "Unser Wenigumstadt - Einblicke
in die Vergangenheit" vom Heimat- und Geschichtsverein
Wenigumstadt S. 110), legte man als Nachweis 2005 einen Schurf
an, der in geringer Tiefe von etwa 50 cm den zersetzten, hellen
Sandstein erreichte. Karl-Dieter JAKOB vom Heimat- und
Geschichtsverein Wenigumstadt e. V. konnte keine Proben
vorlegen, so dass das nicht nachgeprüft werden konnte.
- Nur etwa 200 m südwestlich befand sich einst eine "Porzelain-Grube",
eingezeichnet in der historischen topographischen Karte um
1840 (siehe Bayern-Atlas - wenn die Eintragung korrekt
vorgenommen wurde). Im Uraufnahmeblatt von 1846 findet sich an
dem Ort der Eintrag "Damm", also den Hinweis auf den
Lieferort. Wenn man die heutigen Reste deutet, dann befand
sich die Grube nur etwa 100 m südöstlich, in einem Gelände,
welches durch steile Bereiche und Teiche hervor sticht.
Die Entdeckung fußt wahrscheinlich auf den Beobachtungen des
Dr. Franz Seraph CZIHAK von der Steingutfabrik in Damm (1827 -
1884). Abgebaut wurden unter Daniel Ernst MÜLLER im Jahr 1833
52.000 Ztr. (~10.400 t) "mageren Tons" zum Schlämmen in
Wenigumstadt und Kleinwallstadt (STENGER 1948:38, 90f). Das
wären in einer damaligen 6-Tagewoche ungefähr 34 t am Tag;
wenn man noch Feiertage hinzu rechnet, wäre die Masse pro Tag
noch größer. Das erscheint doch etwas viel für einen Abbau von
Hand, der jahreszeitlichen und witterungsbedingten
Schwankungen (z. B. Frost!) bzw. Einschränkungen unterlag,
auch wenn man davon ausgeht, dass vor Ort geschlämmt wurde und
man nur den Tonanteil nach Damm transportierte. Dafür hätte
man in Wenigumstadt große Mengen an Wasser und auch Teiche
gebraucht. So ein Betrieb hätte in der Region um 1830 als
"Großbetrieb" gegolten. Und was sollte man in Damm mit
etlichen Tonnen Ton pro Tag anfangen? Der relativ kleine
Steingutbetrieb wäre mit 1 t Ton am Tag sicher gut bedient
gewesen, zumal ja auch noch Tone aus Klingenberg und
Schweinheim verwandt wurden. Man erzeugte ja größtenteils
figürliches Steingut, welches keine Massenware war, die mit
Maschinen hergestellt wurden. Also wenn man das zusammen fügt,
dann wäre man mit 54 t pro Jahr ausreichend versorgt. 34 t am
Tag hätten für eine Ziegelei gereicht.
Sicher gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bericht, dass
man Scheuersand gewann und der Gewinnung von Rohstoffen für die
Steingutfabrik in Damm. Aber ohne analysierbare Proben lässt
sich das nicht belastbar auflösen. Aus dem Grund wurden am
12.11.2025 mit einem Bohrstock Proben gezogen, die den Sandstein
und auch entfärbte Stückchen antraf. Für einen sicheren Nachweis
braucht man einfach einen Bagger.
Quellen:
BEHLEN, S. (1823a): Der Spessart. Versuch einer Topographie
dieser Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-,
Forst-, Erd- und Volkskunde.- Erster Band, 274 S., ohne Abb., 1
großformatige, ausklappbare Tab., [F. A. Brockhaus] Leipzig.
BEHLEN, S. (1823b): Der Spessart. Versuch einer Topographie
dieser Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-,
Forst-, Erd- und Volkskunde.- Zweiter Band, 192 S., ohne Abb.,
[F. A. Brockhaus] Leipzig.
GRAICHEN, G. (2009): Limes. Roms Grenzwall gegen die Barbaren.-
351 S., zahlreiche farb. Abb., [Scherz S. Fischer Verlag GmbH]
Frankfurt a. Main.
LENZEN, O. (2022): Das große Buch vom Sand. Die Vielfalt im
Kleinen.- 368 S., 553 Abb. als Fotos, Tab. und Zeichnungen,
[Haupt Verlag] Bern.
LEPPER, K. (1980): Die Golwäscherei am Rhein. Gechichte und
Technik. Münzen und Medaillenaus Rheingold.- Sonderband 3
Reihe der Geschichtsblätter für den Kreis Bergstraße der
Arbeitsgemeinschaft der geschichts- und Heimatvereine im Kreis
Bergstraße, 205 S., einige SW-Abb., [Buchdruckerei Otto KG]
Heppenheim.
LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte
Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 16, 4 Abb..- in Karlsteiner
Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom
Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.
LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG,
G. HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.
Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende
Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,
geologische, petrographische, mineralogische und
bergbaukundliche Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- IV
+ 912 S., 2.532 meist farbigen Abb., 134 Tab. und 38 Karten
(davon 1 auf einer ausklappbaren Doppelseite), [Helga Lorenz
Verlag] Karlstein.
MILKE, R. (2012): Geomaterials in the manuscript
archive: the composition of writing sands and the regional
distribution of writings-sand in SW-Germany and northern
Switzerland, 14th to 19th century.- European Journal of
Mineralogy Vol. 24, Number 4 - July, August 2012, p. 759
- 770, 4 figs., 3 tab., [E. Schweizerbart´sche
Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.
OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart.
Geologische Entwicklung und Struktur, Gesteine und Minerale.- 2.
Aufl., Sammlung Geologischer Führer Band 106, VIII, 368
Seiten, 103 größtenteils farbige Abbildungen, 2 farbige
geologische Karten (43 x 30 cm) [Gebrüder Borntraeger]
Stuttgart.
STENGER, E. (1948): Die Steingutfabrik Damm bei Aschaffenburg
1827 - 1884.- 208 S., unveränderter Nachdruck 1990 als
Veröffentlichung des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg
e. V., 117 Abb., davon 24 Seiten als Anhang, [Verlagsdruckerei
Schmidt GmbH] Neustadt a. d. Aisch..
Zurück zur Homepage
oder an den Anfang der Seite